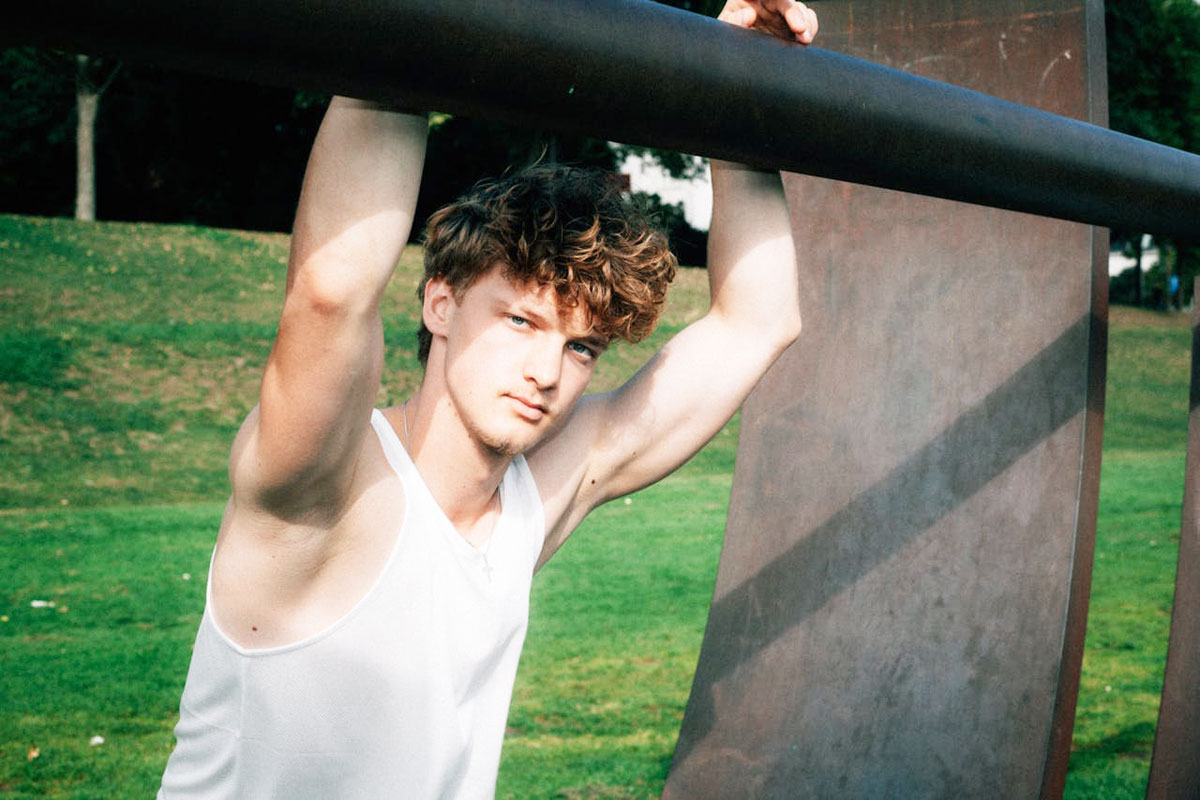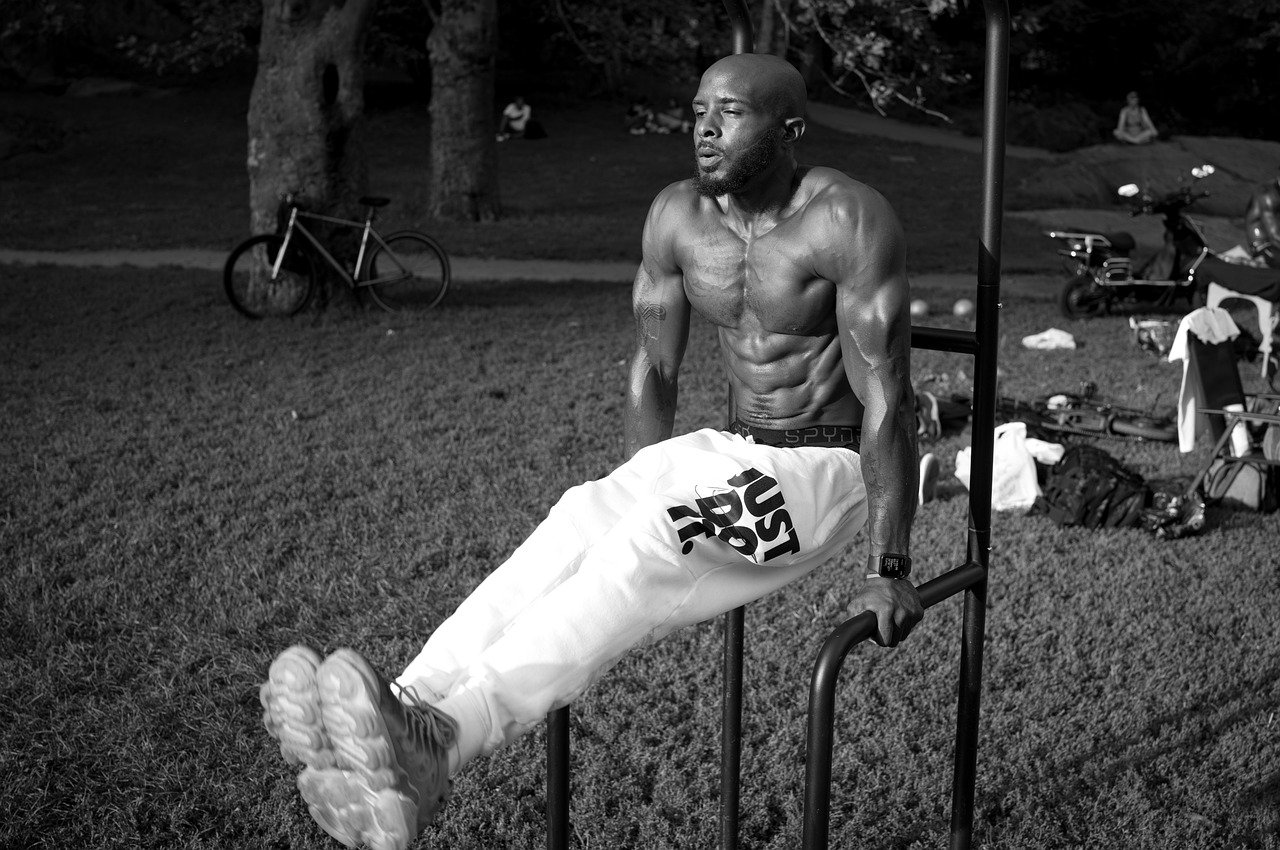Warum Persönlichkeit im Kraftraum plötzlich zählt
Motivation ist selten ein Kalenderspruch-Problem und fast immer ein Passungsproblem: Passt die Trainingsform zu dem Menschen, der sie ausführt? Die Sportpsychologie beantwortet diese Frage zunehmend präzise. Die aktuelle Forschung ordnet Trainingsfreude, Durchhaltevermögen und sogar messbare Fitness an den „Big Five“ der Persönlichkeit: Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und Offenheit.
Der Clou: Nicht jeder profitiert gleich von derselben Intensität – und wer sich dauerhaft quält, bricht eher ab. Klingt banal, ist aber wissenschaftlich unterfüttert und für Trainingsplanung Gold wert.
Was die UCL-Studie konkret untersucht hat
Die Universität College London testete erst Baseline-Fitness und Persönlichkeit und ließ anschließend ein achtwöchiges Heimprogramm laufen. 132 Personen kamen ins Labor, 86 schlossen alles ab. Die Teilnehmenden wurden alters-, geschlechts-, BMI- und V̇O₂peak-gematcht in eine Interventionsgruppe (drei Radeinheiten in wechselnden Intensitäten plus eine Krafteinheit pro Woche) und eine Kontrollgruppe mit ruhigen Dehnübungen eingeteilt.
Die Forscher:innen nutzten einen sehr kurzen Big-Five-Fragebogen (BFI-10, für Verträglichkeit um ein Item erweitert), erfassten u. a. aerobe Leistungsfähigkeit (V̇O₂peak, anaerobe Schwelle, Spitzenleistung) und ließen nach jeder Einheit die Trainingsfreude bewerten. Zusätzlich wurden Stresswerte vor und nach dem Programm erhoben.
Das Design beantwortet drei praktische Fragen:
(1) Sagen Persönlichkeitsmerkmale die Ausgangsfitness voraus?
(2) Erklären sie, welche Intensitäten den meisten Spaß machen?
(3) Verändert Persönlichkeit die Effekte eines konkreten Programms auf Fitness und Stress?
Die wichtigsten Ergebnisse – ohne Marketing-Magie
Erstens: Persönlichkeit erklärt Fitnessunterschiede bereits vor dem ersten Trainingsplan. Extraversion sagte höhere V̇O₂peak, eine bessere anaerobe Schwelle und mehr Spitzenleistung vorher. Gewissenhaftigkeit korrelierte mit mehr wöchentlichen Aktivitätsstunden und insgesamt besserer „Grundfitness“.
Zweitens: Persönlichkeit filtert, was sich gut anfühlt: Extravertierte mochten besonders hohe Intensitäten und Ausbelastungstests, Menschen mit höherem Neurotizismus mieden alles, was lange, gleichförmige Anstrengung erfordert. Offenheit – oft mit Neugier verknüpft – war ausgerechnet ein negativer Prädiktor für den Spaß an HIIT und Schwellenfahrten.
Drittens: Alle, die durchhielten, wurden fitter; die größten emotionalen Gewinne hatte jedoch die Gruppe mit hohem Neurotizismus: Der subjektive Stress sank hier am deutlichsten. Und noch ein Detail mit Praxisfolgen: Wer neurotischer ist, ließ Herzfrequenz-Tracking häufiger weg – Trainingskontrolle ist also nicht für alle ein Motivationsbooster.
Big Five × Trainingspräferenz: Was die Daten nahelegen
| Persönlichkeitsmerkmal | Tendenz bei der Intensität | Praxis-Hinweis |
|---|---|---|
| Extraversion | Mehr Freude an hoher Intensität und Ausbelastung | Plan mit HIIT-Blöcken, klare Spitzenreize, gern sozial |
| Gewissenhaftigkeit | Gute Baselines, konsistentes Training – Intensität zweitrangig | Struktur, Routinen, Zieltracking – kaum „Gamification“ nötig |
| Neurotizismus | Unlust bei langem, gleichförmigem Druck | Kurzformate mit Pausen; Privatsphäre; weniger Kontroll-Gadgets |
| Offenheit | Weniger Spaß an HIIT/Schwellentraining | Kreative Mischung, Technik-/Bewegungsvielfalt, moderat fordernd |
| Verträglichkeit | Harmonie vor Härte | Längere, angenehme Ausdauereinheiten ohne Wettkampfton |
Einordnung: Stärken, Grenzen – und was Headlines gern unterschlagen
Stark ist die Kombination aus objektiver Leistungsdiagnostik, klarer Intervention und wiederholter Spaßmessung nach Intensitäten. Ebenso wertvoll: Die Ergebnisse passen zur breiteren Literatur, die Extraversion mit Aktivität und Gewissenhaftigkeit mit Gesundheitsverhalten verknüpft. Grenzen? Die Stichprobe war nicht komplett repräsentativ:
Über 70 % der Freiwilligen beschrieben sich selbst als offen, gewissenhaft und emotional stabil – das verzerrt die Passung zur Allgemeinbevölkerung. Außerdem kreist die Intervention eng um Heim-Cycling plus Eigenkraftübungen; Sportvergangenheit und Subfacetten (z. B. „Grit“, Ängstlichkeit) wurden nicht analysiert. All das schmälert nicht den Kernbefund, mahnt aber zur Vorsicht bei plakativen „Der Neurotiker muss HIIT machen“-Parolen.
Was Trainer:innen und ambitionierte Hobbysportler daraus machen
1) Intensität individuell kalibrieren: Wer extravertiert ist, darf Spitzenreize ausreizen; wer neurotischer tickt, braucht eher Intervalle mit klaren Erholungsfenstern statt zäher Dauereinheiten.
2) Steuerung passend wählen: Für einige motiviert Metrik-Kontrolle (Herzfrequenz, Zonen, Zeit in Intensität), für andere wirkt derselbe Monitor wie eine ständige Klassenarbeit.
3) Programme für Gewissenhafte nicht überdesignen: Diese Gruppe läuft ohnehin. Geben Sie Ziele, Wochenstruktur und Raum für eigenständige Umsetzung.
4) Offenheit produktiv kanalisieren: Vielfalt ja, Überforderung nein. Technik-Drills, Skill-Circuits, Outdoor-Variationen – moderat, nicht maximal.
5) Stress als Outcome ernst nehmen: Dass gerade neurotische Personen den größten Stressrückgang zeigen, ist ein Hebel für Compliance: Versprechen Sie nicht nur Fitness, sondern spürbare Entlastung.
Kleine Typologie ohne Schubladen
Persönlichkeitsmerkmale sind Tendenzen, keine Urteile. Menschen sind Mischtypen; Lebensphase, Schlaf, Umfeld und Tagesform verschieben Präferenzen. Die UCL-Daten geben Leitplanken, keine Fesseln: Wenn Sie bei der Spinning-Klasse das Gefühl haben, ein Goldfisch im Toaster zu sein, liegt das nicht an mangelnder Disziplin – wahrscheinlich passt das Reizprofil nicht zu Ihrem Kopf. Die Lösung ist nicht „mehr Härte“, sondern bessere Passung. Und ja: Wer ein Format gern macht, macht es öfter. Genau das ist Trainingswissenschaft in alltagstauglich.
Ausblick: Von der Studie zur intelligenten Periodisierung
Der nächste Schritt ist eine Periodisierung, die Persönlichkeit und Zielverlauf verbindet: Aufbauphasen mit Format-Experimenten, Wettkampfblöcke mit maßgeschneiderten Intensitätsachsen, Regenerationswochen, die Stressreduktion als KPI führen. Dafür braucht es keine teure App – nur ehrliches Monitoring von Freude, Anstrengung und Erholung. Die UCL-Studie zeigt, wo man suchen muss. Den Rest erledigen kluge Coaches und Athlet:innen mit gesundem Menschenverstand.
Quellen
[1] Ronca, F.; Tari, B.; Xu, C.; Burgess, P. W. (2025). "Personality traits can predict which exercise intensities we enjoy most, and the magnitude of stress reduction experienced following a training program". Frontiers in Psychology, 16:1587472. DOI:10.3389/fpsyg.2025.1587472.
[2] University College London (08.07.2025). "Personality type can predict which forms of exercise people enjoy". UCL News.
[3] EurekAlert! (08.07.2025). "Personality type can predict which forms of exercise people enjoy". AAAS.
[4] Albrecht, H. (07.08.2025). "Trainingsmotivation: Sport? Och nö!". DIE ZEIT, Nr.33/2025.