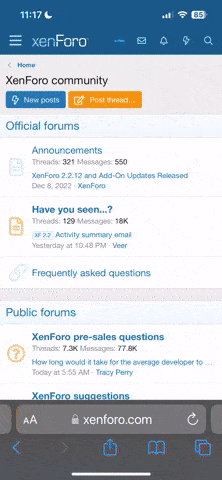Da werden wir wohl unterschiedlichler Meinung bleiben, denn es gibt genügend Studien die anderes behaupten!
Hier nochmal einige ANDERE Info´s:
Aminosäuren
Die Frage, ob Proteine bzw. Protein-Hydrolysate mit dem vollständigen und unveränderten Aminosäuren-Spektrum der betreffenden biologischen Quelle oder einzelne Aminosäuren als Reinsubstanzen zu bevorzugen sind, lässt sich nicht eindeutig beantworten.
Das folgende Beispiel möge zur Veranschaulichung dienen: In einer Studie zu Glutamin aus verschiedenen Quellen galt das Augenmerk der Glykogen-Resynthese nach einem intensiven Training. Die Kontroll-Gruppe erhielt Glukose (0,8 g/kg KG). Die Verum-Gruppen erhielten zusätzlich entweder 0,3 g/kg KG reines Glutamin, ein Weizenprotein-Hydrolysat (26% Glutamin) oder ein Molkenprotein-Hydrolysat (6,6% Glutamin). Die Plasmaglutamin-Konzentration fiel während der Erholungsphase in der Kontroll-Gruppe um 20% ab, der Spiegel blieb konstant in den beiden Proteinhydrolysat-Gruppen, und in der Glutamin-Gruppe kam es zu einem Anstieg auf das Doppelte. Die Glykogen-Resynthese war zwar im Wesentlichen in allen vier Gruppen gleich; leichte Vorteile (+20%, allerdings statistisch nicht signifikant) gab es aber für die Weizen- und die Molken-Proteinhydrolysat-Gruppe. Eine Kohlenhydrat/Glutamin-Mischung führt zu keiner erhöhten Glykogen-Resynthese nach erschöpfendem Training, was auch von anderen Arbeitsgruppen bekannt war. Auffallend dabei ist, dass unabhängig vom Glutamin-Gehalt in den beiden Proteinhydrolysat-Gruppen die Insulin-Konzentration im Vergleich zur Glukose-Gruppe und zur Glukose/Glutamin-Gruppe während der Erholungszeit verdoppelt war (wenngleich ebenfalls nicht signifikant). Nach drei Stunden der Erholungszeit gab es keine Unterschiede bezüglich der Insulin-Konzentrationen in den vier Gruppen mehr. Es darf aber der vorsichtige Schluss gezogen werden, dass durch die erhöhte Insulin-Konzentration in den beiden Proteinhydrolysat-Gruppen die Aktivität der Glykogensynthese erhöht ist, was für die Glykogen-Resynthese und die Erholung von Sportlern von Vorteil sein dürfte. Glutamin spielt dabei offenbar eine permissive Rolle für die insulinotrope Wirkung anderer Aminosäuren im Protein-Hydrolysat; selbst hat es diesbezüglich keine Wirkung (30).
Man kennt noch viel zu wenig die biochemischen Zusammenhänge im Stoffwechsel-Geschehen; offenbar können verschiedene Schienen wie der Eiweiß-Stoffwechsel und der Kohlenhydrat-Stoffwechsel an bisher unbekannten Kreuzungen zusammentreffen und einander gegenseitig beeinflussen. Die Supplementierung mit Kohlenhydraten und Eiweiß-Konzentraten bringt einen moderaten Gewinn für die Leistungsfähigkeit; es sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt (31).
Für die Verwendung der freien Aminosäuren sowie kurzkettiger Peptide (bis 4 AS) spricht, dass sie schneller und effektiver resorbiert werden als nicht aufgeschlossene Proteine. Die Aminosäuren- oder Kurzpeptid-Aufnahme soll sich in einer beschleunigten Wiederherstellung der Muskulatur nach Belastungen bemerkbar machen.
Einen ersten Einzug in die Fachliteratur haben jene Aminosäuren gehalten, die im Rahmen der Immunonutrition zur unterstützenden Behandlung von Tumorpatienten, AIDS-Kranken oder Patienten mit außerordentlichem metabolischen Stress, z.B. nach schweren Verbrennungen, eingesetzt werden. Das Ziel ist die Verbesserung des Immunstatus (Perative®, Nutricomp Immun®, Supportan®, Impact®, Alitraq®, Advera®, Stresson®). Als mögliche profitable Wirkungen ins Treffen geführt werden die Stabilisierung der Lymphozyten-Funktion durch Glutamin, der zytoprotektive Effekt von Glycin, die Unterstützung der Leukozyten durch Taurin, die verbesserte Lymphozytenfunktion und Wundheilung durch Arginin und die Verbesserung der Fettsäuren-Umsetzung bzw. des Energie-Stoffwechsels durch Levocarnitin.
Weitere Stoffgruppen, die in diesem Zusammenhang Erwähnung verdienen, sind die Omega-3-Fettsäuren (32), Nukleotide, lösliche Ballaststoffe und Antioxidantien (33, 34).
Glücklicherweise sind toxische Überdosierungsfolgen bei der Aufnahme von Eiweiß bzw. von Aminosäuren bei Gesunden bis jetzt nicht bekannt geworden. Der beim leistungssportlichen Training verstärkte Aminosäuren-Abbau ist am erhöhten Serumharnstoff-Spiegel erkennbar.
Bei starken Belastungen stammt der Ammoniak aus zerfallendem AMP, bei mittleren Ausdauerbelastungen aus der Desaminierung von Aminosäuren gemäß ihrer Bedeutung im Muskel-Stoffwechsel zum überwiegenden Teil aus den verzweigtkettigen Aminosäuren (branched chain amino acids – BCAA, Leucin, Isoleucin, Valin).
Freier Ammoniak würde Symptome der Ermüdung bis zu Bewusstseinsstörungen auslösen, die motorische Koordination beeinträchtigen (Gleichgewichtsstörungen, Kollaps). Erhöhte Ammoniak-Spiegel in den Muskelzellen, z.B. größer als 0,25 mmol/l, sollen zu Muskelkrämpfen während intensiver Ausdauerbelastungen führen (Abb. 3) (35).
Ammoniak wird in Form von Glutamin und Alanin untoxisch gebunden und in die Leber abgeführt, wo die definitive Entsorgung im Harnstoff-Zyklus geschieht. Dabei handelt es sich um einen Kreislauf, in dem aus Kohlendioxid, Ammoniak und dem Alpha-Aminogruppen-Stickstoff der Asparaginsäure Harnstoff gebildet wird.
Ornithin wird mit Carbamoyl-Phosphat, dem Primär-Produkt aus den Abfallprodukten CO2 und NH3, zunächst zu Citrullin carbaminoyliert und dieses mit Asparaginsäure weiter zu Arginin aufgebaut. Dabei wird die Zwischenstufe Arginyl-Succinat durchlaufen, die bemerkenswert ist, da hier der Harnstoff-Zyklus mit dem Zitronensäure-Zyklus verknüpft ist. Die Abspaltung von Arginin setzt Fumarsäure (Fumarat) frei, die über Äpfelsäure (Malat) zur Schlüsselverbindung Oxalessigsäure umgesetzt wird. Oxalacetat kann via Phosphoenol-Pyruvat der Glukoneogenese in der Leber dienen, unter Verknüpfung mit Acetyl-CoA in den Zitronensäure-Zyklus eingehen oder über Transaminierungs-Reaktionen, vorzugsweise mit Glutaminsäure, zu Asparaginsäure reagieren – als Vorbereitungsreaktion für neuerlichen Eintritt in den Harnstoff-Zyklus. Arginin spaltet Harnstoff ab, und das verbleibende Ornithin steht für den nächsten Entsorgungsdurchgang bereit.
Während sich beim moderaten Training die Serumharnstoff-Konzentration auf einen Wert zwischen 5 und 7 mmol/l einpendelt (bei Frauen 1 mmol/l niedriger), kann dieser bei Überlastung auf 9–12 mmol/l ansteigen. Zu beachten ist, dass einmalige Protein-Aufnahmen, z.B. ein 200 g-Steak, 300 g Käse oder Aminosäuren-Konzentrate die Serumharnstoff-Konzentrationen um 1–2 mmol/l zusätzlich erhöhen. Die Ausscheidungsleistung der Niere beträgt 12,6–28,6 g/24 Sunden nach vollständiger Filtration in den Glomeruli und teilweiser Rückresorption in den Tubuli; sie ist erniedrigt bei Niereninsuffizienz und Lebererkrankungen, jedoch erhöht bei gesteigertem Eiweißabbau (36).
Welche Wirkungen können nun von einzelnen Aminosäuren erwartet werden?
Hormon-Haushalt (Wachstumshormon, Kortisol, Testosteron)
Arginin und Ornithin erhöhen bei peroraler Verabreichung von Mengen ab je 12 g/Tag die Freisetzung von Wachstumshormon. Daraus leitet sich ihre Anwendung zur Unterstützung des Muskelwachstums ab. In kleinen Mengen, z.B. 3–5 g peroral pro Tag, gibt es keine Stimulation der Freisetzung von Wachstumshormon. Die Steigerung der Arginin-Zufuhr bis auf 30 g/Tag sollte keine unerwünschten Wirkungen mit sich bringen (Neumann 2000).
Unter Belastung finden sich stark erhöhte Kortisol-Spiegel. Kortisol ist eines der biochemischen Korrelate zur Stressreaktion und sorgt für die Bereitstellung von Substrat zur Energie-Gewinnung (Erhöhung des Blutzucker-Spiegel, eiweißkatabole Wirkung).
Testosteron ist bei Ausdauerbelastungen zu Beginn erhöht, mit Fortdauer der Belastung sinken die Spiegel jedoch unter die Ausgangswerte (37). Ein Trend zur Erhöhung des Testosteron-Spiegels findet sich bei Leucin-Supplementierung (Mero et al 1997).
Förderung der Glukoneogenese (Insulin), Regeneration
Eine stressbedingte Abnahme der Blutglukose-Konzentration geht über eine Aktivierung der hypothalamisch-hypophysären-adrenalen Achse mit einer erhöhten Freisetzung von ACTH und Kortisol, erhöhten Wachstumshormon- und erniedrigten Insulin-Spiegeln einher (38). Der Insulin-Spiegel ist bereits ab der Aufwärmphase und während der gesamten Belastung erniedrigt.
Nach der Belastung ist eine intensive Freisetzung von Insulin erwünscht, da Insulin als einziges Hormon eine zuckeranabole, d.h. Glykogen-aufbauende Wirkung ausübt; auf die Bedeutung von Glutamin in Eiweiß-Mischungen wurde bereits hingewiesen.
Die BCAA in Dosierungen von 4–16 g sind für die Stabilität des Zucker-Haushaltes während der Belastung sehr nützlich, weil sie zur vermehrten Freisetzung von Alanin beitragen, das als Precursor der Glukoneogenese gilt, und die Abnahme des Glutamins vermindern.
Muskelanabole Wirkung
Auf den Muskelstoffwechsel wirken mehrere Aminosäuren aufbauend (anabol): Arginin (2–12 g/Tag), Ornithin (2–12 g/d), Tryptophan (1–2 g/d, in Verbindung mit Arginin und Ornithin), Valin, Leucin und Isoleucin (1,6 g, 2,2 g bzw. 1,6 g/Tag).
Insulin unterstützt zusammen mit dem Wachstumshormon den Aufbau neuer Gewebsstrukturen und fördert den trainingsinduzierten Muskelaufbau.
Förderung der Ausdauerleistungsfähigkeit
Arginin-Aspartat bringt die Energie-Gewinnung auf die Schiene der Kohlenhydrate und verbessert die aerobe Kapazität; insbesondere ist die verstärkte Umsetzung von Milchsäure (Laktat) zu Brenztraubensäure (Pyruvat) zu vermerken.
Die Aufnahme von 5–10 g Glutamin wirkt schonend auf die Glykogen-Speicher und verkürzt deren Wiederherstellung.
Eine Schlüsselstellung in der Unterstützung der Regeneration und in der energetischen Sicherung von Langzeitbelastungen haben die BCAA. Sie sind ein unentbehrlicher Kohlenhydrat-Ersatz in Kohlenhydrat-Mangelsituationen. BCAA fördern die Leistungsstabilität bei Extrembelastungen wie Ultratriathlon, Marathonläufen oder Zeitfahren.
Ferner sind BCAA beim Höhentraining untersucht worden, wo sie den Muskelschwund vermindern.
Schlafförderung
Tryptophan wirkt durch die Erhöhung der Serotonin-Bildung im Gehirn fördernd auf den Schlaf. In dieser Eigenschaft wird es als mildes Schlafmittel in der Dosierung von 1–1,5 g/Tag empfohlen und soll abends eingenommen werden.
Einflussnahme auf das Immunsystem
Glutamin kann das Immunsystem in seiner Abwehrleistung stabilisieren. Zur Vermeidung eines Übertrainings hat die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und die Abwehrbereitschaft des Immunsystems große Bedeutung (39).
Bei regelmäßigem, fortgesetztem und gesteigertem Training sind die Basiswerte an C-reaktivem Protein (CRP) erniedrigt. Dies kann als entzündungshemmende Wirkung eines intensiven, regelmäßigen Trainings interpretiert werden (40).
Arginin, Asparaginsäure, Arginin-Aspartat, Ornithin
Arginin ist arzneilich zur Therapie der Hyperammonämie zugelassen ist. Als Precursor für Stickstoffmonoxid (NO) hat es eine blutdrucksenkende Wirkung, die bei i.v.-Verabreichung klinisch aufgefallen ist. Die Hyperammonämie ist meist erblich durch Enzym-Mängel im Harnstoff-Zyklus bedingt (Argininbernsteinsäure-Schwachsinn, Citrullinämie) und führt zu Mikrocephalie, Erbrechen, komatösen Zuständen, Oligophrenie und Ataxie. Aus Versuchen an Mäusen ist bekannt, dass bei völligem Fehlen von Arginin im Stoffwechsel verschlechterte kognitive und Lernleistungen auftreten (41).
Arginin ist für die Apotheke insofern interessant, als mit dem Dipeptid Arginin-Aspartat (Sangenor®) ein registriertes Rekonvaleszenzmittel zur Verfügung steht, das klinisch u.a. wegen seiner appetitsteigernden Wirkung angewendet wird.
Für den Sportler sind folgende Aussagen relevant (42, 43): Die Summenwirkung von Arginin-Aspartat scheint in einem verbesserten aeroben Abbau von Kohlenhydraten zu bestehen. Das biochemische Korrelat für diese Aussage findet sich in gegenüber der Kontrollgruppe erniedrigten Laktat-Spiegeln. Die Kreatin-Spiegel unter Arginin-Supplementierung sind erhöht, was durch die Biosynthese des Kreatin, die ihren Ausgang von Arginin und Glycin nimmt, erklärbar ist. Entgegen den Erwartungen sind die Harnstoff-Spiegel nicht erhöht, eher sogar erniedrigt. Dies und die bessere Verfügbarkeit von Glykogen wird damit erklärt, dass in der niedrigen Konzentration und im Konnex mit physischer Belastung Arginin nicht im Harnstoff-Zyklus verbleibt, sondern in den Kohlenhydrat-Stoffwechsel eingeschleust wird. Ferner finden sich in der Verum-Gruppe höhere Blutkalium-Spiegel und – dazu passend – eine höhere Amplitude der T-Welle im EKG. Die Freisetzung von Wachstumshormon, eine vielfach angestrebte Wirkung, ist in diesen niedrigen Konzentrationen tendenziell verringert (44). Zuletzt sollten noch die niedrigeren Fettsäure-Spiegel erwähnt werden, die der Wirkung der Asparaginsäure zugeschrieben werden (45); die Energie-Gewinnung wird durch Sangenor®, wie bereits erwähnt, mehr auf die Schiene der Kohlenhydrate verlegt. Das Ausmaß der Leistungssteigerung darf mit 8–10% veranschlagt werden. In erster Linie werden Schnellkraftsportler und Spielsportler profitieren, die ihre Glykogen-Reserven im Bedarfsfall rasch zur Verfügung haben müssen. Für den Breitensportler könnte man die kurmäßige Anwendung von Sangenor® im Rahmen einer konkreten Wettkampfvorbereitung empfehlen. Um Studienbedingungen zu erreichen, sind 60 Gramm während der letzten 20 Tage vor dem Ereignis zu supplementieren (3-mal 1 g/Tag). Auch der Breitensportler wird sich im Wettkampf maximal verausgaben und seine Energie-Reserven in die Waagschale werfen, ein glykogenspeicherschonendes Verhalten wie im Training ist jetzt nicht mehr angesagt.
In hoher Dosierung ab 12–15 g pro Tag setzt Arginin Wachstumshormon frei (46, 47).
Ornithin wird mit der Nahrung nur in geringen Mengen aufgenommen. Der Organismus kann diese Aminosäure in der Leber aus Arginin bilden. Wie erwähnt, ist Ornithin Komponente des Harnstoff-Zyklus. In der Supplementierung wird Ornithin gewöhnlich zusammen mit Arginin verabreicht; in entsprechend hoher Dosierung (170 mg/kg KG) wird Wachstumshormon vermehrt produziert und nachts während der körperlichen Ruhephase freigesetzt. Die vermutete sekretagoge Wirkung für Insulin ließ sich nicht bestätigen (48).
Die Kombination von Arginin und Ornithin soll den Effekt eines planmäßigen Krafttrainings erhöhen. Die verringerte Ausscheidung von Hydroxyprolin wird als Schutzwirkung vor übermäßigem Gewebsabbau durch chronische Belastung gedeutet (49).
Glutamin, Glutaminsäure
Glutamin ist das 5-Amid der Glutaminsäure (Glutamat) und im Gesamtkörperpool die häufigste Aminosäure. Die therapeutische Anwendung von Glutamin und Glutaminsäure erfolgt bei Erschöpfungszuständen und Kachexie. Immer wieder wird in Studien gefunden, dass es nach starken Belastungen zu einem Abfall von Glutamin in der Größenordnung 12–20% kommt. Die Aufgaben von Glutamin im Organismus sind vielfältig. Für den Sportler umso wichtiger ist seine Funktion als »Ammoniak-Shuttle«. Zum Abtransport von Ammoniak in einer untoxischen Form wird NH3 in Körpergeweben von Glutaminsäure aufgenommen, in der Leber nach einigen Zwischenreaktionen aus dieser wieder freigesetzt und in den Harnstoff-Zyklus irreversibel abgeführt. In Skelettmuskeln gibt es eine weitere Möglichkeit zur Ammoniak-Eliminierung: NH3 wird zunächst durch reduktive Aminierung auf Alpha-Ketoglutarat fixiert; das gebildete Glutamat überträgt NH3 in einer Transaminierungs-Reaktion auf Pyruvat, das nun als Alanin ins Blut und in die Leber gelangt. Dort laufen alle Reaktionen zurück, so dass wieder NH3 in den Harnstoff-Zyklus wandert; Pyruvat könnte im Bedarfsfall für die Glukoneogenese herangezogen werden.
Für den Sportler weiters relevant ist die Funktion von Glutamin als Energie-Substrat für schnell proliferierende Zellen wie Lymphozyten oder Darmzellen. Glutamin liefert ein Drittel der Energie für den Metabolismus der Lymphozyten und Monozyten, insbesondere für deren Nukleotid-Synthese. Bei immunkompetenten Zellen wie Naturalkiller-Zellen, Makrophagen und Lymphozyten steigert es die zelluläre Immunantwort; geringere Mengen gehen Hand in Hand mit einer Verringerung der Lymphozyten-Proliferation. Die Produktion von Interleukin-1 und IL-2 ist gesteigert. In der Verum-Gruppe wird über weniger Infektionszeichen berichtet (50).
In diesem Zusammenhang muss noch einmal der Synergismus mit den Kohlenhydraten betont werden, obwohl die Supplementierung mit Kohlenhydraten keinen unmittelbaren Einfluss auf den Glutamin-Spiegel oder auf den anderer Aminosäuren hat; die Belastung an sich führt zum Abfall der Aminosäuren-Konzentrationen im Plasma mit Fortdauer der Belastung und während der Erholungszeit
Aus sportmedizinischen Untersuchungen ist bekannt, daß durch intensive körperliche Belastung von mehr als einer Stunde erhebliche Mengen an Aminosäuren verlorengehen. Zwei Stunden intensives Kraftausdauertraining führen zu einem Aminosäureverlust von etwa 20g. Ein dreistündiger Marathonlauf kostet bereits etwa 40g Aminosäuren. Der Mensch besitzt einen Aminosäurepool von 100g. Der Abbau dieses Pools wirkt sich ungünstig auf die Proteinsynthese aus, was den Muskelaufbau gefährdet. Die Veränderungen im Aminosäurehaushalt schränken die Fähigkeit des Organismus zu regenerativen Prozessen ein, u.a. die Entgiftung des unter Belastung angefallenen Ammoniak durch die Leber. Die Zufuhr freier Aminosäuren dagegen ermöglicht eine wesentlich schnelle Aufnahme. Bereits nach zehn Minuten nach der Einnahme beginnt die Wiederauffüllung des Aminosäurebestandes im Körper.
Gruss
Serkan