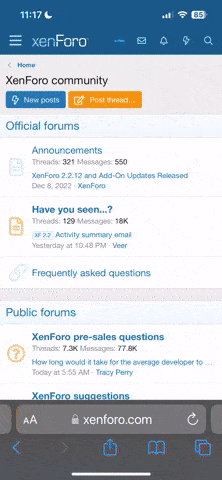@15
Lies mal hier:
Kreatin ist in seiner phosphorylierten Form (ca. zwei Drittel des gesamten Kreatins) Bestandteil des ATP-Kreatinphosphat (KP)-Systems, welches für die anaerobe alaktazide Energiebereitstellung bei Belastungsbeginn sorgt. Im Sauerstoff-steady-state koppelt der sogenannte Kreatin-Shuttle die mitochondriale ATP-Synthese mit der cytosolischen ATP-Resynthese. Der Körper bildet Kreatin in bedarfsdeckenden Mengen, d.h., eine Zufuhr mit der Nahrung ist nicht erforderlich (vgl. Vegetarier). Von den Blutserumwerten kann nicht auf die Kreatinkonzentration in der Skelettmuskulatur (größter Kreatinspeicher) geschlossen werden.
Untersuchungen zum Einfluß hochdosierter Kreatin-Supplemente auf die Konzentration im Muskel weisen immer das "Gesamtkreatin" aus, trennen also nicht zwischen Kreatinphosphat und Kreatin. Die "Gesamtkreatin"-Anreicherung ist umgekehrt proportional zur Ausgangskonzentration, welche positiv mit dem Trainiertheitsgrad korreliert. Die propagierten Wirkungen auf Schnelligkeit, Kraft, Muskelwachstum und Ausdauer sind in kontrollierten Studien bislang nicht bestätigt worden - mit einer Ausnahme: bei intermittierenden hochintensiven Belastungen ist mit einer beschleunigten KP-Resynthese in der Erholungsphase zu rechnen, wodurch die Ermüdung bei nachfolgenden Belastungen hinausgezögert wird.
Da Kreatinmengen zum Einsatz kommen, die unphysiologisch sind und gesundheitliche Schäden hervorrufen können, sollte die Diskussion um die Aufnahme von Kreatin auf die Dopingliste fortgesetzt werden.
Biochemische und physiologische Grundlagen
Die Biosynthese von Kreatin beim Menschen vollzieht sich in Leber, proximalen Nierentubuli, Gehirn, Pankreas und Milz. Im ersten, reversiblen Schritt katalysiert eine Transaminidase die Übertragung der Guanidinogruppe von Arginin auf Glycin. Im zweiten, irreversiblen Schritt wird das entstandene Guanidinoacetat unter Katalyse einer Transmethylase zu Kreatin methyliert. Als CH3-Gruppendonator dient S-Adenosylmethionin. Da die Guanidinoacetat-Transmethylase in den Muskelfasern nicht nachweisbar ist, wird die Kreatinkonzentration im Skelettmuskel durch die Aufnahme von Kreatin aus dem Blut bestimmt. Durch Trans-phosphorylierung kann im Muskel Kreatin in Kreatinphosphat umgewandelt werden. Bei dieser von der Kreatinkinase katalysierten Reaktion geht ATP in ADP über. Der Abbau von Kreatinphosphat zu Kreatinin erfolgt durch Ringschluß unter Abspaltung von anorganischem Phosphat. Kreatinin wird kontinuierlich ins Blut abgegeben, in den Nieren glomerular filtriert und ausgeschieden. Da die Ausscheidung proportional zur Muskelmasse erfolgt, wird Kreatinin in der Labordiagnostik als Bezugsgröße für die Ausscheidung anderer Harnbestandteile herangezogen. Erhöhte Kreatinin-Werte im Plasma sind Ausdruck von Nierenfunktionsstörungen (LÖFFLER/PETRIDES 1997).
Funktionen von Kreatin(phosphat)
Kreatinphosphat (KP) ist Bestandteil des ATP-KP-Systems der Energiebereitstellung. Durch Abspaltung des Phosphatrests und Übertragung auf ADP unter Katalyse der cytosolischen Kreatinkinase wird ATP regeneriert, dessen Spaltung den Muskelfasern die nötige Energie zur Kontraktion liefert. Die Reaktion benötigt keinen Sauerstoff. Im Gegensatz zur anaeroben Glycolyse wirkt sie alkalisierend, da Protonen gebunden werden (DAWSON u.a. 1978). Verlauf der ersten 70 s einer Belastung unterhalb der aeroben Schwelle (2 mmol Laktat/l Blut) sinkt die KP-Konzentration im Muskel um 55 Prozent. Bei einer Belastung oberhalb der aeroben Schwelle ist sie bereits nach 30 s um 73 Prozent vermindert (MADER/HECK 1991).
Nach Erreichen des Sauerstoff-steady-states liegt die muskuläre KP-Konzentration selbst bei hoher submaximaler Intensität höchstens 30 Prozent unterhalb des Ruhewerts (BINZONI u.a. 1992). Durch die mitochondriale Kreatinkinasereaktion wird das bei Belastungsbeginn gespaltene KP teilweise regeneriert (CERRETELLI u.a. 1980). Der sogenannte Kreatin-Shuttle verbindet die oxidative Phosphorylierung im Mitochondrium mit der ATP-Resynthese im Cytosol (MAKLER 1985): Die an den Kontaktstellen von innerer und äußerer Mitochondrienmembran lokalisierte Kreatinkinase ("mitochondriale Kreatinkinase") verwendet das aus der mitochondrialen Respiration hervorgehende ATP, um die Phosphorylierung des im Zwischenmembranraum befindlichen Kreatins zu katalysieren. Das entstehende KP diffundiert zu den Kreatinkinase-Isoenzymen im Cytosol und an der Plasmamembran ("cytosolische Kreatinkinase"), wo die Übertragung des Phosphatrests von KP auf ADP katalysiert wird. Das verbleibende Kreatin diffundiert zurück ins Mitochondrium.
Kreatin-Supplementierung: Dosis und Dauer
Die üblicherweise zur Supplementlerung eingesetzte Dosis an Kreatinmonohydrat beträgt 20 g pro Tag. Diese werden in 4 Portionen zu 5 g peroral verabfolgt. Die Dauer der Anwendung liegt bei 5 bis 6 Tagen. Gelegentlich wird die Supplementierung für 4 Wochen mit 2 g pro Tag fortgesetzt. Dieses Applikationsschema basiert auf den Unter-suchungsergebnissen von HARRIS u.a. (1992) und HULTMANN u.a. ( 1996)
oder auch hier:
Physiologische Grundlagen zum Kreatin
(nach Weineck)
Im Organismus eines 70 kg schweren Mannes befinden sich etwa 120 bis 140 g Kreatin (Methyl-Guanidin-Essigsäure). Davon sind etwa 95 % im Skelettmuskel eingelagert Die schnellzuckenden Muskelfasern (FT Fasern) haben einen höheren Kreatingehalt als die langsam zuckenden (ST Fasern).
Das Kreatin, das bei der Muskelkontraktion verbraucht wird, wird über den Blutstrom ersetzt. Eine Muskelübersäuerung steigert die Umwandlung von Kreatin in sein Abbauprodukt Kreatinin. Bei intensivem Training ist daher das Kreatinin erhöht.
Bei der Phosphorilierung wird Kreatin im Muskel mit Phosphor zum energiereichen Kreatinphosphat aufgebaut, das seinerseits Energie für den Aufibau von Adenosintriphosphat (ATP), dem biologischen Energielieferanten für die Muskelkontraktion, liefert. Die Reserven an ATP in der Muskulatur sind, sehr gering und reichen bei maximaler Belastung (Maximalkraft-, Schnellkraft- oder Schnelligkeitsleistungen) nur für eine Arbeitsdauer von höchstens 1-3 Sekunden. Bei längeren Arbeitszeiten mit maximaler Auslastung wird das ATP über die Verbindung von Adenosindiphosphat (ADP) und Kreatinphosphat (KP) resynthetisiert. Je größer nun die Reserven an muskeleigenem KP bzw. seinem Grundbaustein Kreatin sind, desto länger kann die Muskulatur maximale Kontraktionsleistungen erbringen. Demnach erweisen sich für Sportler, bei denen die Maximalkraft, die Schnellkraft oder die Schnelligkeit leistungslimitierend ist, erhöhte Speicher von Kreatin bzw. KP als vorteilhaft.
Die körpereigenen Kreatinmengen unterliegen Schwankungen, da sie von verschiedenen endogenen und exogenen Faktoren abhängig sind, wie z. B. vom Muskelfasertyp, vom Alter, vom Geschlecht, von der Ernährung, von verschiedenen Erkrankungen sowie vom Training bzw. Trainingszustand.
Der hohe Verbrauch von Kreatin für die Bildung von Kreatinphosphat in Maximalkraft-, Schnellkraft-, Schnelligkeits- und intensiven Schnelligkeitsausdauerbelastungen (Kurzzeit-Intervalltraining) führt zu einem Abfall des Kreatins. Sprinttraining erhöht den Kreatinphosphatgehalt im Muskel, steigert aber auch seinen Bedarf. Eine exogene Erhöhung der Blut-Kreatin-Konzentration durch eine entsprechende Ernährung bzw. Kreatin-Supplementierung führt zu einem gesteigerten Kreatineinbau in die Muskelzellen. Der Kreatineinbau ist erhöht, wenn zusätzlich Kohlenhydrate hinzugefügt werden.
Der tägliche Kreatin-Bedarf beträgt etwa 2 g/Tag. Sprint- bzw. intensives Intervalltraining erhöht ihn.
Da sollte alles nützliche drinstehen
Sind auch diesmal keine Studien sondern nur Texte, welche ich aus dem Netz hab, da die Formulierung recht verständlich ist.
Gruß patrick