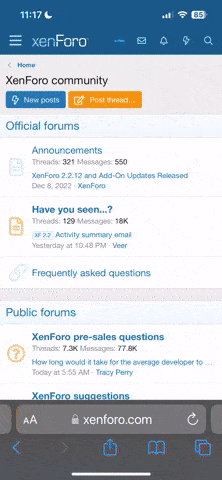Dann vielleicht so:
lieber Klaus:
Alkohol
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel befasst sich mit dem speziellen Alkohol Ethanol, der u.a. Ausgangsstoff für alkoholische Getränke ist; die generelle Bedeutung des Begriffs ist unter Alkohol (Chemie) zu finden.
--------------------------------------------------------------------------------
Umgangssprachlich wird unter Alkohol speziell der vom Ethan abgeleitete Alkohol mit der chemischen Bezeichnung Ethanol (früher Äthanol) oder Ethylalkohol verstanden. Generell werden in der Chemie alle organischen Verbindungen als Alkohole bezeichnet, deren charakteristische funktionelle Gruppe die Hydroxy-Gruppe (-OH) ist. Viele dieser Alkohole sind giftig. Daneben gibt es andere wie das Glycerin oder die Zuckeralkohole, die das nicht sind.
Der Begriff Alkohol entspringt dem spanischen alcohol, was ursprünglich feines, trockenes Pulver bedeutete und in der Alchemistensprache verwendet wurde. Im Arabischen steht al kuhl für Augenschminke.
Anmerkung: Im Folgenden bezeichnet Alkohol immer die chemische Substanz Ethanol (C2H5OH)
1 Verfügbarkeit
2 Herstellung
3 Aufnahme und Abbau
3.1 Unmittelbare physiologische Wirkung
3.2 Wirkungen auf das Gehirn und andere Schäden
3.3 Todesursache Alkohol
3.4 Mögliche positive gesundheitliche Wirkungen
4 Gesetzliche Beschränkungen
4.1 Jugendschutz
4.2 Straßenverkehr
5 Kulturgeschichte des Alkohols
6 Populationsgenetische Aspekte des Alkohols
7 Andere Nutzung von Alkohol
8 Literatur
9 Weblinks
Verfügbarkeit
Alkohol wird gewöhnlich in alkoholischen Getränken verfügbar gemacht und ist eine der am weitesten verbreiteten Drogen.
Alkohol enthaltende Getränke (mit Angabe des Alkoholgehaltes in Volumenprozent):
reifer Kefir: bis ca. 3%
Bier
Leichtbiere: 1-2,5%
Vollbiere: ca 3-5%, meist um 5%
Starkbiere: 6-12%
Weine: 7-15%, meist um 12%
Met: ca. 5-14%
Liköre: ca. 15-75%, meist unter 30%
Spirituosen: ca. 30-96%
Alkohol kann jedoch auch in Form von Spiritus eingekauft werden. Dieser enthält meist 96% Ethylalkohol, der mit Hilfe von Vergällungsmitteln ungenießbar gemacht wurde. Vergällter Alkohol ist nämlich von der Genussmittelsteuer befreit, Trinkalkohol nicht.
Herstellung
Alkohol entsteht u.a. bei der Vergärung von zucker- oder stärkehaltigen Substanzen durch Hefen oder Bakterien (Bsp. Tequila). Daher wird dieser Prozess kontrolliert mit einer Reihe von Nahrungsmitteln durchgeführt, wodurch zum Beispiel Wein (aus Weintrauben) oder Bier (aus Malz und Hopfen) entstehen. Durch Destillation kann der Alkoholgehalt noch erhöht bzw. fast reiner Alkohol (Azeotrop) gewonnen werden. Solche Getränke bezeichnet man als Spirituosen (z.B. Whiskey, Kognak, Schnaps, Wodka oder Rum). Liköre sind Spirituosen, denen Zucker und Aromen zugesetzt werden.
Aufnahme und Abbau
Alkohol wird im gesamten Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Dies beginnt bereits in der Mundschleimhaut. Der dort aufgenommene Alkohol geht direkt in das Blut und wird damit über den gesamten Körper einschließlich des Gehirns verteilt. Der im Darm aufgenommene Alkohol gelangt dagegen zunächst mit dem Blut in die Leber, wo er teilweise abgebaut wird. Die Alkoholaufnahme wird durch Faktoren, die die Durchblutung steigern, erhöht, beispielsweise Wärme (Irish Coffee, Grog), Zucker (Likör) und Kohlenstoffdioxid (sog. Kohlensäure in Sekt). Fett dagegen verlangsamt die Aufnahme. Dies führt aber nicht zu einer niedrigeren Resorption des Alkohols insgesamt, sondern nur zu einer zeitlichen Streckung. In der Leber wird der Alkohol durch das Enzym Alkoholdehydrogenase zu Ethanal (H3C-CHO) abgebaut, das weiter zu Ethansäure (Essigsäure) oxidiert wird. Die Ethansäure wird über den Citratzyklus und die Atmungskette in allen Zellen des Körpers unter Energiegewinnung zu CO2 veratmet. Das Zwischenprodukt Ethanal ist auch für den so genannten Kater verantwortlich, der eine Folge stärkeren Alkoholkonsums ist. Der Abbau des Ethanols wird durch Zucker gehemmt, daher ist die Katerwirkung bei süßen alkoholischen Getränken, insbesondere Likör, Bowlen und manchen Sektsorten besonders hoch.
Die Abbaurate durch die Alkoholdehydrogenase ist innerhalb gewisser Grenzen konstant. Sie beträgt bei den meisten Europäern knapp 1 g Alkohol je 10 kg Körpergewicht und Stunde. Eine Variationsbreite ergibt sich zwischen Männern und Frauen. Bei Männern wurde auch im Magen eine genetisch bedingte erhöhte Aktivität der so genannten gastrischen Alkoholdehydrogenase festgestellt, was zu einer leichten Erhöhung der Abbaurate führt. Die Abbaurate wird dagegen durch häufigen Alkoholkonsum nicht erhöht. Der Gewöhnungseffekt, den man bei Alkoholikern beobachten kann, beruht nicht auf schnellerem Abbau, sondern auf der Gewöhnung des Nervensystems an höhere Giftdosen. Andere, insbesondere in unsauber destillierten Spirituosen zu findende Alkohole, die so genannten Fuselalkohole, werden auch durch die Alkoholdehydrogenase abgebaut und verlangsamen den Abbau des Alkohols. Etwa 5 Prozent des Alkohols werden über Urin, Schweiß und Atemluft abgegeben.
Siehe auch: Kater
Unmittelbare physiologische Wirkung
Alkohol führt zu einer Erweiterung insbesondere der äußeren Blutgefäße. Daraus ergibt sich ein Wärmegefühl beim Konsum alkoholhaltiger Getränke. Dabei wird die natürliche Regulierung des Wärmehaushalts bei niedrigen Temperaturen außer Kraft gesetzt. Zugleich wirkt Alkohol betäubend, so dass bedrohliche Kälte nicht mehr wahrgenommen wird. Daher können Erfrierungen bis hin zum Kältetod die Folge winterlichen Alkoholgenusses sein.
Problematisch ist auch die Kombination von Alkohol mit Medikamenten und anderen Drogen. Hier gibt es vielfältige Wechselwirkungen, die zu einer vorzeitigen und intensiveren Beeinträchtigung als bei reinem Alkoholkonsum führen können. Auch der Alkoholabbau hinterlässt noch nach seiner Beendigung physiologische Wirkungen: So bleibt die Konzentration des Enzyms Alkoholdehydrogenase auch noch nach vollständiger Beseitigung des Alkohols aus dem Blut erhöht. Dieses Enzym ist aber auch am Abbau von Medikamenten beteiligt, so dass diese schneller als in der Dosierung vorgesehen abgebaut und damit unwirksam gemacht werden.
Wirkungen auf das Gehirn und andere Schäden
Bereits maßvoller Alkoholgenuss (0,2 Promille Blutalkohol - entsprechend ungefähr 0,3 l Bier, 100 ml Wein oder einem hochprozentigen Schnaps, je nach Körpergewicht und Konstitution) wirkt sich auf das Nervensystem und speziell auf das Gehirn aus: das Blickfeld wird verengt (beginnender Tunnelblick), und die Reaktionszeiten verlangsamen sich. Schätzungen gehen davon aus, dass beim Verzehr eines Bieres bis zu 100.000 Gehirnzellen abgetötet werden. Bei einem Vollrausch sollen sogar ca. 10.000.000 Gehirnzellen unwiderruflich absterben. Weiterer Genuss von Alkohol führt zu einem als Trunkenheit bezeichneten Zustand. Dieser ist einerseits durch körperliche Veränderungen wie z.B. psychisch durch erhöhte Emotionalität, andererseits durch eine veränderte Bewusstseinwahrnehmung und verringerte geistige Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Meistens führt erheblicher Alkoholgenuss zu Übelkeit und Erbrechen. Dabei wird allerdings nur der Teil des Alkohols ausgeschieden, der noch nicht in die Blutbahn gelangt ist.
Alkohol hat auch eine Wirkung auf Sexualität und Fruchtbarkeit. So führt Alkoholgenuss vielfach zu einer Enthemmung, speziell bei Männern auch zu einer Steigerung der Libido. Parallel dazu verringert sich allerdings die Erektionsfähigkeit bis hin zur völligen erektilen Dysfunktion. Darüberhinaus gehört Alkohol zu den Stoffen, die sich direkt schädigend auf Hoden und Spermien auswirken. Alkohol führt zu einer Verminderung der Testosteronproduktion, was negative Auswirkungen auf eine Vielzahl von Körperfunktionen hat. Neuere Untersuchungen (Prof. E. Abel, USA) haben festgestellt, dass väterlicher Alkoholkonsum vor der Zeugung nicht nur das Risiko von Fehlgeburten erhöht, sondern sich auch schädigend auf die Kindesentwicklung auswirken kann. Wesentlich verheerender ist allerdings Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, da sich dadurch unter anderem das so genannte fetale Alkoholsyndrom ausbilden kann, das vor allem durch eine erhebliche Beeinträchtigung der Intelligenz beim Kind gekennzeichnet ist. Alkoholbedingte Schädigungen gehören zu den häufigsten pränatal bedingten Gesundheitsschäden.
In noch größeren Mengen setzt eine akute Alkoholvergiftung ein, die bis zum Koma oder dem direkten Tod führen kann. Besonders gefährlich ist dabei der schnelle Genuss von Spirituosen, da die Übelkeitsschwelle langsamer eintritt als ein lebensbedrohlicher Anstieg des Blutalkoholspiegels.
Auch wenn die angenehmen Wirkungen leichten Konsums im Fall positiver Anlässe zeitlich beschränkt erwünscht sein mögen, so ruft Trunkenheit andererseits in unangebrachten Situationen jährlich ein unübersehbares Maß an menschlichem Leid hervor (Verkehrsunfälle, etc.). Ebenso kann auch dauerhafter Konsum allein schon oder zusammen mit anderen Faktoren zu schweren gesundheitlichen Schädigungen führen: Herz-Kreislauferkrankungen, schwere Schädigungen der Leber, des gesamten Nervensystems, des Gehirns und körperlich-psychische Abhängigkeit.
Hilfen bieten Ärzte oder Selbsthilfegruppen wie die Anonymen Alkoholiker oder die Guttempler.
Todesursache Alkohol
In Deutschland sind im Jahr 2000 circa 16.000 Menschen durch Alkohol-Missbrauch gestorben. Dies wären rund zwei Prozent aller Sterbefälle. Männer sind dabei dreimal häufiger betroffen als Frauen. Die häufigste alkoholbedingte Todesursache ist die alkoholische Leberzirrhose mit 9.550 Verstorbenen. (Quelle: Statistisches Bundesamt). Eine Krankheit mit über 50% Mortalität, die insbesondere zusammen mit einer sehr fetthaltigen Mahlzeit von Alkohol ausgelöst werden kann, ist die Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung).
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die Staatsekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Marion Caspers-Merk spricht für 2003 von 40.000 Todesfällen als Folge des Alkoholkonsums in Deutschland (Zum Vergleich: Drogentod durch illegale Drogen 1.477, Tod als Folge des Tabakrauchens: 110.000).
(Quelle: Drogen- und Suchtbericht 2004)
Mögliche positive gesundheitliche Wirkungen
Es ist stark umstritten, ob alkoholische Getränke poitiv auf die Gesundheit einwirken können. Viele vordergründing positive Wirkungen werden durch andere aufgehoben, etwa der stark erhöhten Krebsgefahr beim regelmässigen Kosum selbst geringer Mengen, die durch wissenschafliche Studien bestätigt wurden.
Mediziner warnen davor, einzelne Wirkungen aus dem Gesamtzusammenhang zu reissen.
Auch der Verbrauch von Vitaminen und Mineralstoffen beim Abbau im Körper ist zu berücksichtigen.
Traubensaft enhält dieselben herzstärkenden Mittel wie Wein, daher kann davon ausgegangen werden, das das selektive Hervorheben einzelner positver Wirkungen in erster Linie einer Rechtfertigung dient und wenig Substanz hat.
Aus einer Anzahl epidemiologischer Untersuchungen geht hervor, dass ein ausgesprochen mäßiger Konsum bestimmter alkoholhaltiger Getränke - insbesondere Rotwein - (etwa 1-2 Glas pro Tag) über längere Zeiträume vor koronarer Herzerkrankung schützen soll. Außerdem wurde bei bis zu 20-40 g Alkohol bei Männern und bei bis zu 10-20 g bei Frauen eine höhere Lebenserwartung festgestellt. Dies entspricht 1/4 Rotwein oder 1/2 Maß Bier pro Tag. Die höhere Lebenserwartung ist allerdings nur ein statistischer Effekt, da unter den Antialkoholikern auch Personen sind, die gerade wegen einer Krankheit und damit verbundener niedriger Lebenserwartung keinen Alkohol trinken.
Oberhalb dieser Mengen kehrt sich die positive Wirkung eindeutig um. Ursächlich für diese Wirkungen ist allerdings nicht der Alkohol selbst, sondern Begleitstoffe, die im Wein und Bier zu finden sind und durch den Alkohol, der ein gutes Lösungsmittel ist, verfügbar gemacht werden (Lösungsmitteltheorie). Daher besitzen Schnäpse und die meisten Liköre auch keine vergleichbaren Wirkungen. Nach einer anderen Theorie wirkt (wenig) Alkohol entzündungshemmend, der CRP-Gehalt (Reaktive Proteine) sinkt.
J. Kauhanen et. al: Beer binging and mortality: results from the Kuopio ischaemic heart desease risk factor study, a prospective population based study. British Medical Journal 1997/315/S.846.
E. B. Rimm et al.: Moderate alcohol intake and lower risk of coronary heart desease: meta-analysis on effects on lipds and haemostatic factors. British Medical Journal 1999/319/s. 1523.
K. Nanchal et al.: alcohol consumption, metabolic cardiovascular risk factors and hypertension in women. International Journal on Epidemiology 2000/29/S.57.
C. Power et al.: U-shaped relation for alcohol consumption and health in early adulthood and implications for mortality. Lancet 1988/352/S.877
H. Beck-Bornholdt et al.: Der Hund, der Eier legt 2001 ISBN 3-499-61154-
Gesetzliche Beschränkungen
In einigen vorzugsweise islamischen Ländern ist Alkohol als Droge gesetzlich streng verboten. Manche Getränke wie Absynth sind oder waren bis vor kurzer Zeit wegen ihres erhöhten Gefahrenpotentials auch in vielen europäischen Ländern verboten.
Jugendschutz
In Deutschland und der Schweiz dürfen alkoholische Getränke nur an Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr abgegeben werden. Getränke, die Branntwein enthalten, sogar erst ab 18.
In Österreich ist der Jugendschutz Ländersache. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist der Alkoholgenuss grundsätzlich erst ab 16 gestattet. In den anderen Ländern dürfen Getränke bis zu einem Alkoholgehalt von 14% mit 16, solche darüber mit 18 getrunken werden.
In manchen Ländern, insbesondere den USA, gelten oft Bestimmungen, die als Mindesalter 21 vorsehen.
Straßenverkehr
Da Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinflusst, gibt es einen höchstzulässigen Alkoholgehalt im Blut. Dieser beträgt
in Österreich:
0,1‰ für Lenker von Lastwägen und Autobussen, für Lenker mit Probeführerschein, für Moped- und Traktorfahrer bis 20 Jahre, sowie für Schüler und Lehrer in der praktischen Fahrausbildung.
0,5‰ für Kraftfahrzeuglenker
0,8‰ für Fahrzeuglenker
in Deutschland: 0,5‰
in der Schweiz: 0,8‰, ab 1. Januar 2005: 0,5‰
in Serbien, Kroatien, Tschechien, Slowenien, Montenegro, Rumänien und Bulgarien: 0,0‰
Gruß Rainer