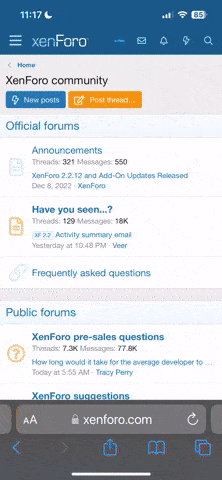Marathon-Trainingsplan
Hallo Danajak,
wenn du jetzt schon 3h-Läufe machen kannst, würde ich mich schon sehr wundern, wenn du nicht finishen würdest. Mehr noch, mit 1:55 im HM und dieser jetzt schon vorhandenen Ausdauer kannst du ohne Probleme die 3:59 angreifen ...
Von Peter Greif (
www.greif.de) ist folgende Tabelle:
<font color=blue>
Ermittlung des Marathon-Renntempos aus der Halbmarathonzeit
4 Lauftage/Woche, 50 - 70 km/Woche: Halbmarathonzeit x 2 + 12 min = Marathonzeit
5 Lauftage/Woche, 70 - 90 km/Woche: Halbmarathonzeit x 2 + 10 min = Marathonzeit
6 Lauftage/Woche, 90 - 110 km/Woche: Halbmarathonzeit x 2 + 8 min = Marathonzeit
7 Lauftage/Woche, 110 - 130 km/Woche: Halbmarathonzeit x 2 + 7 min = Marathonzeit</font color=blue>
Allerdings sind IMHO für einen Marathon, der Spaß machen soll, 3 Lauftage die Woche das absloute Minimum, besser sind 4 oder mehr (je näher der M-Day rückt).
Ein Plan zum Aufbau von Grundlagenausdauer könnte so aussehen:
Jan
Mo Ruhetag
Di schneller Lauf (bis 88% HFmax)
Mi Ruhetag
Do mittlerer Lauf (~75% HFmax)
Fr Ruhetag
Sa mittlerer Lauf oder anderer Ausdauersport
So Langer Lauf (~70% HFmax) 120 -> 150 Minuten
In der Entlastungswoche (4. Woche) reicht es, den Langen Lauf wegzulassen oder auf 60 Minuten zu reduzieren.
Feb genauso, Langer Lauf 150 -> 180 Min
März
Mo Ruhetag
Di schneller Lauf, Strecke verlängern, ~ 90% HFmax
Mi Ruhetag, evtl. 30min Regenerationslauf (bis 70% HFmax) oder 45min Radfahren (hohe Trittfrequenz, wenig Kraft)
Do mittlerer Lauf, Strecke/Dauer verlängern
Fr wie Mi
Sa kürzerer schneller Lauf oder Intervalle
So Langer Lauf 180 min
In der Entlastungswoche kannst du statt des Langen Laufes einen mittleren Lauf wie am Do machen, die Tempo-Einheiten solltest du beibehalten. Effekt: geringerer km-Umfang erholt, gleichzeitig "vergißt" der Körper sein "Wettkampftempo" nicht.
Damit hast du schon eine
sehr solide Grundlage für einen Frühjahrsmarathon!
Zusätzliches Krafttraining an den lauffreien Tagen machst du ja schon. Für den schnellen Lauf mind. 10min warmlaufen und 15min auslaufen, mit 20-30min anfangen und im Lauf der Wochen auf 40-50min steigern.
Nüchtern-Läufe sind unnötig (der durch Kohlehydratmangel verursachte erhöhte Anteil des Fettstoffwechsels hat
keinen Trainingseffekt! s.a.
http://www.fitness.com/phpapps/ubbthreads/showthreaded.php?Cat=&Board=de_fitness&Number=67313&page=9&view=collapsed&sb=5&o=0&fpart= im Gegenteil, KH-haltige Getränke nimmt der Körper besser auf!
http://gin.uibk.ac.at/gin/freihtml/trinken_im_sport.htm Wichtig ist allein die absolvierte Laufdauer! Dass die Long Jogs allmählich auf gleichem Untergrund wie der Marathon gelaufen werden sollten, ist hoffentlich selbstverständlich.
Falls du mehr Tempoarbeit machen willst (März-Mai), kannst du meinen HM-Plan als Inspiration nehmen (vor meinem Marathon waren die km-Umfänge auch nicht höher):
LDL=langsamer DL, FDL= flotter DL, FS = Fahrtspiel, REG = Regenerationslauf, IV = Intervalle (wie TDL = Tempodauerlauf immer mit E/A = Ein- u. Auslaufen), WK=Wettkampf
Brutto-km sind incl. aller E/A und IV-Trabpausen
Ruhetage nicht extra erwähnt
KW9 LDL 24km in 2:30, 80%HFmax
___ REG 9 km in 1:00, 65% HFmax
___ IV 4x1,2km je 6:00, 90% HFmax
___ Berg-IV 3x 1,5km (50HM). . . . brutto 49km, 5h
KW10 FDL 15? km in 1:35, 82%
____ IV 5x1,2km je 5:10, 85-95%
____ LDL 27km in 2:42, 80% . . . . brutto 53km, 5h
KW11 IV 4x1500 je 7:00
____ REG 8km in 1:00
____ FDL/FS 12km in 1:00, 80-90%
____ FDL 14km in 1:30, 84% zzgl. 6km E/A . . . .brutto 50km, 5h
KW12 REG 6km in 0:40
____ IV 6x1500 je <7:00, 90%
____ Berg-IV 5x1,5 je 9:30
____ LDL 15?km in 1:30, <80%
____ LDL 8km in 0:50, 75% . . . . brutto 67km, 6h
KW13 LDL 12km in 1:10, ?%
____ IV 7x1500 in 6:30, 90%
____ LDL 8km in 0:50, ?%
____ LDL/FS 15km in 1:30, 75-90% . . . brutto 52km, 5h
KW14 LDL 30km in 2:45, 80%
____ TDL 10km in 44:00 (windig), 90%
____ REG ?km in 1:00, ca. 70%
____ LDL/FS 13km in 1:20, 70-85%
____ LDL 24km in 2:00, 80% . . . brutto 78km, 7,5h
KW15 LDL/FS 16km in 1:35, 70-85%
____ REG 0:50, 70%
____ Berg-IV 4x1,5km je<8:30, 90%+
____ LDL 30km in 2:38, 80% . . . brutto 67km, 7h
KW16 TDL 10km in 40:35, 90-95%
____ REG ?km in 0:35, ?%
____ LDL 22km in 1:54, 75% . . . brutto 40km, 4h
KW17 Berg-IV 4x1,5km je <8:00, 90-100% *)
____ REG 8km in 0:50, 65%
____ FDL 26km in 2:02, 84-88%
____ REG 8km in 0:50, ?%
____ IV 4x2,0km je 8:30, 86-88% ²)
____ REG 7km in 0:45
____ FDL/TDL 21,1km in 1:39, 83-89% ³) . . . . brutto 97km, 9h
KW18 REG 7km in 0:45, 70%
____ REG 8km in 0:50, 70%
____ LDL 8km in 0:45, 75%
____ HM-WK: 21,1km in 1:27, 88% . . . brutto 45km, 4h
*) neue HFmax beim Überholen zweier Vereins-MTBer bergauf

))))) OK, war wirklich steil ...
²) Test-Intervalle: Tempoermittlung für 88%HFmax
³) Testlauf (WK-Uhrzeit, Kleidung/Schuhe, Frühstück 2h vorher etc.), erste 16km in 4:50, letzte 5km in 4:12
Gruß
chianti