App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
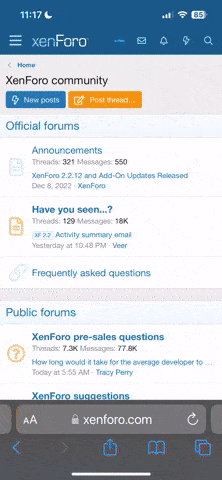
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Kre Alkalyn bei ausdauer- und anschliessendem kraftsport
- Ersteller AndreL
- Erstellt am
A
Anzeige
schau mal hier:
vor oder nach dem training .
premutos667
New member
monohydrat tuts auch. krealkalyn ist monohydrat mit basenpulver. bringt nicht mehr. kenne zumindest keinen, bei dem es irgendwie besonders gewirkt hätte. abgesehen davon ist monohydrat günstiger und du kommst länger aus.
Dauereinnahme Mono: etwa 5 g - spielt keine rolle, wann du es nimmst. es spielt auch keine rolle, wann du krea nimmst.
Dauereinnahme Mono: etwa 5 g - spielt keine rolle, wann du es nimmst. es spielt auch keine rolle, wann du krea nimmst.
premutos667
New member
Adenosintriphosphat (ATP) [Bearbeiten]
Der direkt verfügbare ATP-Speicher reicht unter starken muskulären Beanspruchungen nur aus, um für ungefähr eine bis zwei Sekunden, also ein bis drei Muskelkontraktionen[2], Energie bereitzustellen. Selbst unter der Voraussetzung, dass ATP bis zu AMP gespalten wird, herrscht im ruhenden Muskel nur ein ATP-Vorrat von ca. 6 µMol/g = 6 mMol/kg.[4] Wenn man nun die Tatsache bedenkt, dass der Mensch täglich soviel ATP verbraucht, wie es seinem Körpergewicht entspricht, ist es also umso erstaunlicher, dass ATP, das doch als so wichtig für die Muskelkontraktion gilt und die einzige unmittelbare Energiequelle darstellt, nur so beschränkt in der Muskelzelle vorhanden ist.
Kreatinphosphat (PKr) [Bearbeiten]
Da der im Muskel vorhandene ATP-Vorrat nur für eine bis drei Muskelkontraktionen ausreicht (ungefähr 2 Sekunden Belastungsdauer)[5], muss der Körper ständig um eine Resynthese des ATPs als lebensnotwendige Substanz bemüht sein. Hier kommt das Kreatinphosphat ins Spiel, welches eine energiereiche chemische Verbindung aus Kreatin (Kr) und einem Phosphatrest ist. Die vorliegende Bindung zwischen dem Phosphat und dem Kreatin hat ein dem ATP entsprechendes Energiepotential. Durch die schnell ablaufende Reaktion:
ADP + Kreatinphosphat ↔ ATP + Kreatin
wird durch die Abspaltung des Phosphatrestes und dessen Übertragung auf ADP das ATP resynthetisiert.[6] Zudem ist PKr in etwa drei- bis viermal so großer Menge (20-30 µMol/g) gegenüber dem ATP in der Muskelzelle vorrätig.[7] Der Kreatinphosphatspeicher ist also von großer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur, da er bei starker Konzentrationsarbeit ungefähr 10 Sekunden (Untrainierte ca. 6 s, Hochtrainierte ca. 12-20 s)[8] lang in der Lage ist, die dafür notwendige Energie bereitzustellen. Außerdem ist es die Energiequelle, welche das ATP sofort resynthetisieren kann, bis dann zu einem späteren Zeitpunkt andere Reaktionswege aktiviert sind.
Im Kreatinphosphat wird des Weiteren eine entscheidende Rolle als Energiegefälle gesehen, wodurch hohe Substratdurchsätze ermöglicht werden. Es steht auch fest, dass der Kreatinphosphatgehalt von der Höhe und Dauer der geleisteten Arbeit abhängt. Kommt es zu extrem starken Belastungen, kann der Kreatinphosphatspeicher fast vollständig ausgeschöpft werden und nach Ende der Belastung schnell wieder aufgefüllt werden. Sollte es jedoch dazu kommen, dass die Nachlieferung der energiereichen Phosphate unterbleibt, kommt es zu einem Erlöschen der Kontraktionsfähigkeit des Muskels.[9]
quelle: Wiki
Der direkt verfügbare ATP-Speicher reicht unter starken muskulären Beanspruchungen nur aus, um für ungefähr eine bis zwei Sekunden, also ein bis drei Muskelkontraktionen[2], Energie bereitzustellen. Selbst unter der Voraussetzung, dass ATP bis zu AMP gespalten wird, herrscht im ruhenden Muskel nur ein ATP-Vorrat von ca. 6 µMol/g = 6 mMol/kg.[4] Wenn man nun die Tatsache bedenkt, dass der Mensch täglich soviel ATP verbraucht, wie es seinem Körpergewicht entspricht, ist es also umso erstaunlicher, dass ATP, das doch als so wichtig für die Muskelkontraktion gilt und die einzige unmittelbare Energiequelle darstellt, nur so beschränkt in der Muskelzelle vorhanden ist.
Kreatinphosphat (PKr) [Bearbeiten]
Da der im Muskel vorhandene ATP-Vorrat nur für eine bis drei Muskelkontraktionen ausreicht (ungefähr 2 Sekunden Belastungsdauer)[5], muss der Körper ständig um eine Resynthese des ATPs als lebensnotwendige Substanz bemüht sein. Hier kommt das Kreatinphosphat ins Spiel, welches eine energiereiche chemische Verbindung aus Kreatin (Kr) und einem Phosphatrest ist. Die vorliegende Bindung zwischen dem Phosphat und dem Kreatin hat ein dem ATP entsprechendes Energiepotential. Durch die schnell ablaufende Reaktion:
ADP + Kreatinphosphat ↔ ATP + Kreatin
wird durch die Abspaltung des Phosphatrestes und dessen Übertragung auf ADP das ATP resynthetisiert.[6] Zudem ist PKr in etwa drei- bis viermal so großer Menge (20-30 µMol/g) gegenüber dem ATP in der Muskelzelle vorrätig.[7] Der Kreatinphosphatspeicher ist also von großer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur, da er bei starker Konzentrationsarbeit ungefähr 10 Sekunden (Untrainierte ca. 6 s, Hochtrainierte ca. 12-20 s)[8] lang in der Lage ist, die dafür notwendige Energie bereitzustellen. Außerdem ist es die Energiequelle, welche das ATP sofort resynthetisieren kann, bis dann zu einem späteren Zeitpunkt andere Reaktionswege aktiviert sind.
Im Kreatinphosphat wird des Weiteren eine entscheidende Rolle als Energiegefälle gesehen, wodurch hohe Substratdurchsätze ermöglicht werden. Es steht auch fest, dass der Kreatinphosphatgehalt von der Höhe und Dauer der geleisteten Arbeit abhängt. Kommt es zu extrem starken Belastungen, kann der Kreatinphosphatspeicher fast vollständig ausgeschöpft werden und nach Ende der Belastung schnell wieder aufgefüllt werden. Sollte es jedoch dazu kommen, dass die Nachlieferung der energiereichen Phosphate unterbleibt, kommt es zu einem Erlöschen der Kontraktionsfähigkeit des Muskels.[9]
quelle: Wiki
A
Anzeige
schau mal hier:
vor oder nach dem training .