App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
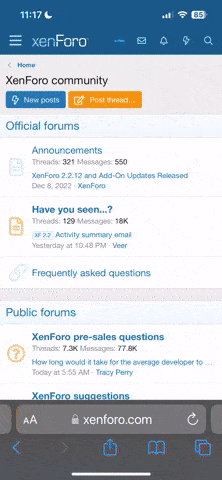
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Komplexe Frage zum Abnehmen
- Ersteller aurenia
- Erstellt am
A
Anzeige
schau mal hier:
Komplexe Frage zum Abnehmen .
Re: kognitive Verhaltenstherapie
VERHALTENSTHERAPIE
. Die Entstehung der Verhaltenstherapie hing einerseits mit der Unzufriedenheit über die vorherrschende Psychoanalyse und andererseits mit der Anwendung experimenteller wissenschaftlicher Ergebnisse auf die Erklärung und Behandlung seelischer Störungen zusammen. Man interessierte sich dafür, wie sehr Lernprozesse und die Umwelt einen Einfluss auf menschliches Verhalten und Erleben haben. Heute umfasst die Verhaltenstherapie ein breites Spektrum von Techniken, deren Grundlage Lerngesetze, Erkenntnisse aus der Experimental- und Sozialpsychologie sowie medizinische Erkenntnisse über den Körper sind. Man hat der Verhaltenstherapie den Vorwurf gemacht, sie sehe den einzelnen Menschen als jemanden, der mechanisch auf Konsequenzen in Form von Belohnungen oder Bestrafungen reagiert oder der ein Opfer körperlicher Reflexe ist. Heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts vertritt die Verhaltenstherapie ein ganzheitliches Bild des Menschen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass der Klient als der Experte seiner Probleme gesehen wird. Der Therapeut bezieht die Entwicklungsgeschichte, Umwelteinflüsse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit in seine Therapieplanung ein. Er fragt dabei nicht nur einseitig nach den Problemen sondern auch nach Ressourcen und Stärken. Der Begriff "Verhaltenstherapie" führt insofern in die Irre, da er das Augenmerk ausschließlich auf das Verhalten lenkt. In der Verhaltenstherapie steht aber heute die Untersuchung des Verhaltens gleichrangig neben der Betrachtung von Denken, Gefühlen und körperlichen Prozessen. Verhaltenstherapie legt dabei besonderen Wert auf die Überprüfung der Wirksamkeit der angewandten Methoden. Ein herausragendes Ziel besteht darin, eine Hilfestellung zur Selbsthilfe und Selbstkontrolle zu geben. Zu Beginn einer Therapie ist eine Klärung über die gemeinsam zu erarbeitenden Ziele erforderlich. Die Kognitive Verhaltenstherapie, die gesondert besprochen wird, wird heute als Teil der Verhaltenstherapie verstanden.
Wie der Name schon sagt, umfasst Kognitive Verhaltenstherapie sowohl kognitive (=Erkenntnis betreffend; Einstellungen, Gedanken, Selbstgespräche, Vorstellungen und Interpretationen) als auch verhaltensbezogene Techniken; sie hat sich seit den 50er Jahren aus der Verhaltenstherapie entwickelt. Wichtige Vertreter dieser Richtung sind A. BECK, A. ELLIS und D. MEICHENBAUM, die ihr Interesse verstärkt auf innere gedankliche und bildhafte Prozesse legen. Grundannahme ihrer Theorien ist, dass Gefühle und Verhaltensweisen ein direkter Ausdruck von Gedanken sind. Deshalb wird im Therapieprozess daran gearbeitet, irrationale, ungesunde und problematische Denkweisen, die mit psychischen Problemen einhergehen, zu verändern. Ein typisches gerne von ELLIS angesprochenes Beispiel ist die Gedankenkette: "Ich muss von allen geliebt und gemocht werden, wenn dies nicht der Fall ist, so ist es schrecklich." Solche Gedanke führen zu Ängsten und/oder Depressivität. Derartige Gedanken werden in der Kognitiven Verhaltenstherapie hinterfragt und bearbeitet, wenn der Klient sich dazu entschieden hat, z.B. die damit verbundenen Probleme verringern zu wollen.
Verhaltenstechniken stammen aus der Verhaltenstherapie und haben einen gleich hohen Stellenwert in der Kognitiven Verhaltenstherapie. Basisannahme dabei ist, dass ungünstige, problematische Verhaltensweisen erlernt wurden und wieder verlernt werden können. Typische Strategien dabei sind zum Beispiel der Aufbau von selbstsicheren Verhaltensweisen, Entspannungsverfahren oder die gezielte Konfrontation mit gefürchteten Objekten.
Sowohl kognitive als auch verhaltensbezogene Techniken haben sich als effektiv in der Behandlung von Ängsten, Phobien (=Ängste vor Objekten) und Depressionen erwiesen. Dies ist vielfach wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen worden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass (Kognitive) Verhaltenstherapie neben tiefenpsychologischen Methoden am ehesten von deutschen Krankenkassen bezahlt wird. Im Gegensatz zu tiefenpsychologischen Ansätzen wird die Kognitive Verhaltenstherapie manchmal als oberflächlich und günstig für "Kurzzeitprobleme" betrachtet. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Kognitive Verhaltenstherapie auf eine breite Anzahl von Problemen angewendet werden kann. Sie unterstützt den Klienten schon sehr frühzeitig darin, seine Probleme langfristig ohne den Therapeuten verändern zu können.
RATIONAL-EMOTIVE VERHALTENSTHERAPIE
Im folgenden wird die von ALBERT ELLIS entwickelte Rational-Emotive Verhaltenstherapie als eine besonders strukturierte und auf Selbsthilfe abzielende Methode vorgestellt. ELLIS entwickelt seit den 50er Jahren als Alternative zur klassischen eher passiven Psychoanalyse und als Erweiterung verhaltenstherapeutischer Techniken die Rational-Emotive Therapie (RET), die er seit einigen Jahren Rational-Emotive Verhaltenstherapie nennt. Er lässt sich dabei besonders von den Stoikern leiten: "Die Menschen werden nicht durch die Dinge selbst verwirrt, sondern durch die Art, wie sie über sie denken." Beeinflusst wurde er auch von den Lehren Bertrand Russells und Alfred Adlers.
Im Mittelpunkt seiner Theorie steht das sogenannte "ABC-Modell der Gefühle", wobei mit A (=activating event) das auslösende Ereignis eines Problems, mit B (=Believes) Gedanken und Bewertungen und mit C (=consequences) Gedanken und Gefühle gemeint sind. Dazu ein Beispiel:
A = Auslösendes Ereignis B = Gedanken und Bewertungen C = Gefühle und Verhalten
"Ich sitze im Bus. Katja setzt sich neben mich." "Jetzt ist wieder eine Möglichkeit, sie zu einem Kaffee einzuladen. Das ist meine letzte Chance, sie zu fragen. Sicherlich sagt sie nein oder ... sie lacht mich aus. Andere hier im Bus bekommen das mit. Sie erzählt es meinem Kollegen und der lacht mich aus. Das wäre mir furchtbar peinlich. Ich könnte mich hier im Bus und bei meiner Arbeit nicht mehr sehen lassen. Gefühle: Angst, Aufregung, Niedergeschlagenheit;
Verhalten: unruhiges Hin- und Herrutschen, Zittern
ELLIS geht davon aus, dass irrationale Bewertungen oder Einstellungen über Erziehungs-, Kultur- und Sozialisationsprozesse erworben worden sind. Jeder Mensch entwickelt eine eigene Philosophie, die sich in seinen Selbstgesprächen widerspiegelt. Dabei werden nicht alle problematischen Verhaltensweisen in den ersten Lebensjahren erworben sondern auch später.
Ein Therapeut, der mit der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie arbeitet, wird unter anderem folgende Techniken einsetzen:
Disputation unangemessener, irrationaler oder ungesunder Denkweisen: Nachdem der Klient und der Therapeut einig darin sind, ein bestimmtes Gefühl, zum Beispiel Angst vor einer Prüfung (in Lampenfieber) zu verändern, wird der Therapeut das bisherige Denken konfrontativ hinterfragen (=disputieren). Er geht dabei wie ein Wissenschaftler mit logischen Denkregeln vor. Wenn der Klient glaubt, ein Versager zu sein, wenn er die bevorstehende Prüfung nicht schafft, fragt ihn der Therapeut z.B., ob er diesen Glauben beweisen kann.
Erstellung von ABCs: Der Therapeut bittet den Klienten, zu Hause ABCs über problematische Verhaltensweisen oder belastende Gefühle zu erstellen. Er soll sich z.B. dann, wenn die Angst kommt, hinsetzen und sich die auslösenden Situationen und seine Bewertungen bewusst machen. Das geht am Besten mit strukturierten Notizen. Im Laufe der Therapie lernt er dabei, zunehmend selbständig eigene unangemessene Denkweisen zu hinterfragen.
Durchführen von Rational-Emotiven Imaginationen (=Vorstellungen): Der Therapeut bittet den Klienten, sich bei verschlossenen Augen ein bestimmtes belastendes Gefühl vorzustellen und die damit zusammenhängenden Gedanken zunächst zu betrachten. Danach verändert der Klient mit dem bewussten Einsetzen der neu erlernten Gedanken das belastende Gefühl. Hier wird also eine belastende Situation zunächst durch mentales Üben bewältigt.
Verhaltensübungen: Nachdem der Klient erlernt hat, bei einem bestimmten Problem anders zu denken, kann er durch eine Verhaltensaufgabe im Alltag lernen, die Veränderungen zu überprüfen. Zum Beispiel kann jemand, der Angst vor Ablehnung hat, kleine Experimente machen, wo er mit Ablehnung rechnen muß und dabei sehen, dass die damit verbundene Erfahrung aushaltbar ist.
Sie sehen daran, dass die Rational-Emotive Verhaltenstherapie eine direkte, eher konfrontative Therapieform ist. Der Therapeut hinterfragt sehr genau die Gedanken und Bewertungen, die zu belastenden Konsequenzen führen und sucht nach gedanklichen Alternativen. Dies geschieht natürlich in einer Atmosphäre des Respekts vor den Problemen des Klienten. Rational-Emtovie Verhaltenstherapie hilft, in Belastungssituationen mit rationalen Mitteln Gefühle und Verhaltensweisen angemessen zu steuern. Dies führt jedoch nicht dazu, dass wir unsere Gefühle verlieren und uns wie ein Roboter verhalten. Ein Beispiel dafür ist Ärger: zu viel davon bringt unser vegetatives Nervensystem in Fahrt und führt zu gesundheitlichen Problemen; leichter Ärger, hingegen motiviert eher, demnächst bessere Lösungen zu finden. Es kommt also auf das Ausmaß eines Gefühls an.
VERHALTENSTHERAPIE
. Die Entstehung der Verhaltenstherapie hing einerseits mit der Unzufriedenheit über die vorherrschende Psychoanalyse und andererseits mit der Anwendung experimenteller wissenschaftlicher Ergebnisse auf die Erklärung und Behandlung seelischer Störungen zusammen. Man interessierte sich dafür, wie sehr Lernprozesse und die Umwelt einen Einfluss auf menschliches Verhalten und Erleben haben. Heute umfasst die Verhaltenstherapie ein breites Spektrum von Techniken, deren Grundlage Lerngesetze, Erkenntnisse aus der Experimental- und Sozialpsychologie sowie medizinische Erkenntnisse über den Körper sind. Man hat der Verhaltenstherapie den Vorwurf gemacht, sie sehe den einzelnen Menschen als jemanden, der mechanisch auf Konsequenzen in Form von Belohnungen oder Bestrafungen reagiert oder der ein Opfer körperlicher Reflexe ist. Heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts vertritt die Verhaltenstherapie ein ganzheitliches Bild des Menschen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass der Klient als der Experte seiner Probleme gesehen wird. Der Therapeut bezieht die Entwicklungsgeschichte, Umwelteinflüsse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit in seine Therapieplanung ein. Er fragt dabei nicht nur einseitig nach den Problemen sondern auch nach Ressourcen und Stärken. Der Begriff "Verhaltenstherapie" führt insofern in die Irre, da er das Augenmerk ausschließlich auf das Verhalten lenkt. In der Verhaltenstherapie steht aber heute die Untersuchung des Verhaltens gleichrangig neben der Betrachtung von Denken, Gefühlen und körperlichen Prozessen. Verhaltenstherapie legt dabei besonderen Wert auf die Überprüfung der Wirksamkeit der angewandten Methoden. Ein herausragendes Ziel besteht darin, eine Hilfestellung zur Selbsthilfe und Selbstkontrolle zu geben. Zu Beginn einer Therapie ist eine Klärung über die gemeinsam zu erarbeitenden Ziele erforderlich. Die Kognitive Verhaltenstherapie, die gesondert besprochen wird, wird heute als Teil der Verhaltenstherapie verstanden.
Wie der Name schon sagt, umfasst Kognitive Verhaltenstherapie sowohl kognitive (=Erkenntnis betreffend; Einstellungen, Gedanken, Selbstgespräche, Vorstellungen und Interpretationen) als auch verhaltensbezogene Techniken; sie hat sich seit den 50er Jahren aus der Verhaltenstherapie entwickelt. Wichtige Vertreter dieser Richtung sind A. BECK, A. ELLIS und D. MEICHENBAUM, die ihr Interesse verstärkt auf innere gedankliche und bildhafte Prozesse legen. Grundannahme ihrer Theorien ist, dass Gefühle und Verhaltensweisen ein direkter Ausdruck von Gedanken sind. Deshalb wird im Therapieprozess daran gearbeitet, irrationale, ungesunde und problematische Denkweisen, die mit psychischen Problemen einhergehen, zu verändern. Ein typisches gerne von ELLIS angesprochenes Beispiel ist die Gedankenkette: "Ich muss von allen geliebt und gemocht werden, wenn dies nicht der Fall ist, so ist es schrecklich." Solche Gedanke führen zu Ängsten und/oder Depressivität. Derartige Gedanken werden in der Kognitiven Verhaltenstherapie hinterfragt und bearbeitet, wenn der Klient sich dazu entschieden hat, z.B. die damit verbundenen Probleme verringern zu wollen.
Verhaltenstechniken stammen aus der Verhaltenstherapie und haben einen gleich hohen Stellenwert in der Kognitiven Verhaltenstherapie. Basisannahme dabei ist, dass ungünstige, problematische Verhaltensweisen erlernt wurden und wieder verlernt werden können. Typische Strategien dabei sind zum Beispiel der Aufbau von selbstsicheren Verhaltensweisen, Entspannungsverfahren oder die gezielte Konfrontation mit gefürchteten Objekten.
Sowohl kognitive als auch verhaltensbezogene Techniken haben sich als effektiv in der Behandlung von Ängsten, Phobien (=Ängste vor Objekten) und Depressionen erwiesen. Dies ist vielfach wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen worden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass (Kognitive) Verhaltenstherapie neben tiefenpsychologischen Methoden am ehesten von deutschen Krankenkassen bezahlt wird. Im Gegensatz zu tiefenpsychologischen Ansätzen wird die Kognitive Verhaltenstherapie manchmal als oberflächlich und günstig für "Kurzzeitprobleme" betrachtet. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Kognitive Verhaltenstherapie auf eine breite Anzahl von Problemen angewendet werden kann. Sie unterstützt den Klienten schon sehr frühzeitig darin, seine Probleme langfristig ohne den Therapeuten verändern zu können.
RATIONAL-EMOTIVE VERHALTENSTHERAPIE
Im folgenden wird die von ALBERT ELLIS entwickelte Rational-Emotive Verhaltenstherapie als eine besonders strukturierte und auf Selbsthilfe abzielende Methode vorgestellt. ELLIS entwickelt seit den 50er Jahren als Alternative zur klassischen eher passiven Psychoanalyse und als Erweiterung verhaltenstherapeutischer Techniken die Rational-Emotive Therapie (RET), die er seit einigen Jahren Rational-Emotive Verhaltenstherapie nennt. Er lässt sich dabei besonders von den Stoikern leiten: "Die Menschen werden nicht durch die Dinge selbst verwirrt, sondern durch die Art, wie sie über sie denken." Beeinflusst wurde er auch von den Lehren Bertrand Russells und Alfred Adlers.
Im Mittelpunkt seiner Theorie steht das sogenannte "ABC-Modell der Gefühle", wobei mit A (=activating event) das auslösende Ereignis eines Problems, mit B (=Believes) Gedanken und Bewertungen und mit C (=consequences) Gedanken und Gefühle gemeint sind. Dazu ein Beispiel:
A = Auslösendes Ereignis B = Gedanken und Bewertungen C = Gefühle und Verhalten
"Ich sitze im Bus. Katja setzt sich neben mich." "Jetzt ist wieder eine Möglichkeit, sie zu einem Kaffee einzuladen. Das ist meine letzte Chance, sie zu fragen. Sicherlich sagt sie nein oder ... sie lacht mich aus. Andere hier im Bus bekommen das mit. Sie erzählt es meinem Kollegen und der lacht mich aus. Das wäre mir furchtbar peinlich. Ich könnte mich hier im Bus und bei meiner Arbeit nicht mehr sehen lassen. Gefühle: Angst, Aufregung, Niedergeschlagenheit;
Verhalten: unruhiges Hin- und Herrutschen, Zittern
ELLIS geht davon aus, dass irrationale Bewertungen oder Einstellungen über Erziehungs-, Kultur- und Sozialisationsprozesse erworben worden sind. Jeder Mensch entwickelt eine eigene Philosophie, die sich in seinen Selbstgesprächen widerspiegelt. Dabei werden nicht alle problematischen Verhaltensweisen in den ersten Lebensjahren erworben sondern auch später.
Ein Therapeut, der mit der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie arbeitet, wird unter anderem folgende Techniken einsetzen:
Disputation unangemessener, irrationaler oder ungesunder Denkweisen: Nachdem der Klient und der Therapeut einig darin sind, ein bestimmtes Gefühl, zum Beispiel Angst vor einer Prüfung (in Lampenfieber) zu verändern, wird der Therapeut das bisherige Denken konfrontativ hinterfragen (=disputieren). Er geht dabei wie ein Wissenschaftler mit logischen Denkregeln vor. Wenn der Klient glaubt, ein Versager zu sein, wenn er die bevorstehende Prüfung nicht schafft, fragt ihn der Therapeut z.B., ob er diesen Glauben beweisen kann.
Erstellung von ABCs: Der Therapeut bittet den Klienten, zu Hause ABCs über problematische Verhaltensweisen oder belastende Gefühle zu erstellen. Er soll sich z.B. dann, wenn die Angst kommt, hinsetzen und sich die auslösenden Situationen und seine Bewertungen bewusst machen. Das geht am Besten mit strukturierten Notizen. Im Laufe der Therapie lernt er dabei, zunehmend selbständig eigene unangemessene Denkweisen zu hinterfragen.
Durchführen von Rational-Emotiven Imaginationen (=Vorstellungen): Der Therapeut bittet den Klienten, sich bei verschlossenen Augen ein bestimmtes belastendes Gefühl vorzustellen und die damit zusammenhängenden Gedanken zunächst zu betrachten. Danach verändert der Klient mit dem bewussten Einsetzen der neu erlernten Gedanken das belastende Gefühl. Hier wird also eine belastende Situation zunächst durch mentales Üben bewältigt.
Verhaltensübungen: Nachdem der Klient erlernt hat, bei einem bestimmten Problem anders zu denken, kann er durch eine Verhaltensaufgabe im Alltag lernen, die Veränderungen zu überprüfen. Zum Beispiel kann jemand, der Angst vor Ablehnung hat, kleine Experimente machen, wo er mit Ablehnung rechnen muß und dabei sehen, dass die damit verbundene Erfahrung aushaltbar ist.
Sie sehen daran, dass die Rational-Emotive Verhaltenstherapie eine direkte, eher konfrontative Therapieform ist. Der Therapeut hinterfragt sehr genau die Gedanken und Bewertungen, die zu belastenden Konsequenzen führen und sucht nach gedanklichen Alternativen. Dies geschieht natürlich in einer Atmosphäre des Respekts vor den Problemen des Klienten. Rational-Emtovie Verhaltenstherapie hilft, in Belastungssituationen mit rationalen Mitteln Gefühle und Verhaltensweisen angemessen zu steuern. Dies führt jedoch nicht dazu, dass wir unsere Gefühle verlieren und uns wie ein Roboter verhalten. Ein Beispiel dafür ist Ärger: zu viel davon bringt unser vegetatives Nervensystem in Fahrt und führt zu gesundheitlichen Problemen; leichter Ärger, hingegen motiviert eher, demnächst bessere Lösungen zu finden. Es kommt also auf das Ausmaß eines Gefühls an.
Humanistische Methoden
Zu humanistischen Methoden:
In der humanistischen Psychologie wird meist “ressourcen-orientiert” gearbeitet, d.h.: Welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten hat eine Person bzw. Gruppe? Welche Entwicklungen sind erreichbar? Wie kann in einer Gruppe ein möglichst für alle “nährendes” Umfeld geschaffen werden, in dem sich auch der Einzelne in seiner Eigenart gesehen wird und sich entwickeln kann? Bei diesen Methoden wird enorm viel Wert darauf gelegt, dass nicht externe "Ratschläge" gegeben werden (die meist sowieso nicht befolgt werden), sondern mittels einer besonderen Vorgehensweise wirklich Raum für eigene Lösungen gefunden wird.
Zu humanistischen Methoden:
In der humanistischen Psychologie wird meist “ressourcen-orientiert” gearbeitet, d.h.: Welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten hat eine Person bzw. Gruppe? Welche Entwicklungen sind erreichbar? Wie kann in einer Gruppe ein möglichst für alle “nährendes” Umfeld geschaffen werden, in dem sich auch der Einzelne in seiner Eigenart gesehen wird und sich entwickeln kann? Bei diesen Methoden wird enorm viel Wert darauf gelegt, dass nicht externe "Ratschläge" gegeben werden (die meist sowieso nicht befolgt werden), sondern mittels einer besonderen Vorgehensweise wirklich Raum für eigene Lösungen gefunden wird.
Themenzentrierte Interaktion
Zur TZI:
Die themenzentrierte Interaktion hat die sogenannte humanistische Richtung in der psychologischen Beratung mit begründet. Gleichzeitig bietet sie einen sehr praktischen und nützlichen Rahmen für eine systemische, dass heißt das "Ganze" in seinen Interaktionen betrachtete Sichtweise. Hier wird postuliert, dass in einer Gruppe drei Faktoren zu berücksichtigen sind: Die Gruppe als Ganzes (das “Wir”), der Einzelne (das “Ich”) und der Sachebene (das "Es"). Diese drei Faktoren sollen möglichst ausbalanciert werden. Sie sind wiederum in eine nur teilweise zu beeinflussende Umwelt eingebettet (in diesem Falle z.B. der Gesamtbetrieb oder ein anderes übergeordnetes System). Gleichzeitig biete die TZI ein Set von Kommunikationsregeln, die einen Prozess von Selbstverwirklichung, Synergie, Kooperation und Effizienzsteigerung wesentlich unterstützen.
Wie können aus dieser Sicht Fehlentwicklungen betrachtet werden? Z.B. ist es in vielen Teams so, dass das Thema, also die Arbeitsvorgänge, sehr stark übergewichtet wird. Wie es dem Einzelnen (das “Ich”) geht, oder wie das Betriebsklima ist (das “Wir”), interessiert nicht. Über kurz oder lang wird darunter auch das das Arbeitsergebnis leiden.
Zur TZI:
Die themenzentrierte Interaktion hat die sogenannte humanistische Richtung in der psychologischen Beratung mit begründet. Gleichzeitig bietet sie einen sehr praktischen und nützlichen Rahmen für eine systemische, dass heißt das "Ganze" in seinen Interaktionen betrachtete Sichtweise. Hier wird postuliert, dass in einer Gruppe drei Faktoren zu berücksichtigen sind: Die Gruppe als Ganzes (das “Wir”), der Einzelne (das “Ich”) und der Sachebene (das "Es"). Diese drei Faktoren sollen möglichst ausbalanciert werden. Sie sind wiederum in eine nur teilweise zu beeinflussende Umwelt eingebettet (in diesem Falle z.B. der Gesamtbetrieb oder ein anderes übergeordnetes System). Gleichzeitig biete die TZI ein Set von Kommunikationsregeln, die einen Prozess von Selbstverwirklichung, Synergie, Kooperation und Effizienzsteigerung wesentlich unterstützen.
Wie können aus dieser Sicht Fehlentwicklungen betrachtet werden? Z.B. ist es in vielen Teams so, dass das Thema, also die Arbeitsvorgänge, sehr stark übergewichtet wird. Wie es dem Einzelnen (das “Ich”) geht, oder wie das Betriebsklima ist (das “Wir”), interessiert nicht. Über kurz oder lang wird darunter auch das das Arbeitsergebnis leiden.
Systematische Therapie
Wenn Menschen mit Depressionen nach einem wissenschaftlich fundierten "Stufenplan" behandelt werden, sind die Erfolgsaussichten deutlich größer. Dies zeigen die soeben ausgewerteten Daten einer zwischen 1997 und 2000 vorgenommenen Untersuchung, der "BERLINER STUFENPLANSTUDIE" am Fachbereich Humanmedizin der FU/Universitätsklinikum Benjamin Franklin (UKBF). Während bei körperlichen Erkrankungen Leitlinien längst akzeptiert sind, waren bei psychischen Krankheiten die Effekte einer systematischen Therapie bisher kaum untersucht. Die Arbeitsgruppe um Dr. Mazda ADLI und Dr. Dr. Michael Bauer von der Psychiatrischen Klinik (Leitung: Prof. Isabella Heuser) der Freien Universität Berlin hat nun die streng leitliniengetreue Therapie der Depression mit der üblichen Behandlung nach individuellem ärztlichen Ermessen verglichen. Die Ergebnisse: weniger chronifizierte Krankheitsverläufe, weniger Medikamente, kürzere Krankenhausaufenthalte.
Dem "Berliner Stufenplan" liegt ein Algorithmus - ein Entscheidungsbaum - zugrunde, der je nach Ansprechen eines Patienten im 14-tägigen Rhythmus das weitere Vorgehen vorschreibt. Das Prinzip ist einfach: Führt die 1. Stufe des Behandlungsplanes im vorgesehenen Zeitraum nicht zum erwünschten Erfolg, wird die 2. Stufe der Therapie beschritten - und so weiter.
Die Patienten in der Stufenplangruppe zeigten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, im Beobachtungszeitraum zu genesen wie die "individuell" behandelten Patienten. Nach Stufenplan therapierte Patienten mussten im Schnitt 18 Tagen kürzer behandelt und konnten zehn Tage früher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Während nach sieben Behandlungswochen die Hälfte der nach Stufenplan behandelten Patienten weitgehend beschwerdefrei war, wurde diese Rate bei nach individuellem Zuschnitt behandelten Patienten erst nach zwölf Wochen erreicht. Die "Stufenplan-Patienten" brauchten ferner nicht nur weniger Medikamente, sondern auch weniger Therapiewechsel. Mit anderen Worten: Die systematisierte Behandlung senkt nicht nur Kosten, sondern kann auch zu einer schonenderen und möglicherweise nebenwirkungsärmeren Therapie führen.
Trotz besserer Medikamente hatte die Depressionsbehandlung in den letzten Jahren stagniert. Die führenden europäischen und amerikanischen Depressionsforscher hatten wiederholt gefordert, leitlinienorietierte Therapien auf den Prüfstand zu stellen. Nach ihren bisherigen, ermutigenden Ergebnissen will die Berliner Gruppe nun ihre Erfahrungen in einer bundesweit angelegten Studie auf noch breitere Basis stellen. Das Projekt wird im Rahmen des Kompetenznetzes Depression als "Algorithmusstudie" realisiert. 450 Patienten sollen, über die Republik verteilt, in die Untersuchung aufgenommen werden. Die Studie prüft auch ein computergestütztes Therapiesystem, das dem behandelnden Arzt in regelmäßigen Abständen eine leitlinienorientierte Entscheidungshilfe anbietet. Viele niedergelassene Ärzte wünschen seit langem eine solche Unterstützung bei der medikamentösen Depressionsbehandlung. Dabei ist selbstverständlich die Psychotherapie integraler Bestandteil.
Das Kompetenznetz Depression will die Krankheit, ihre Symptome und Behandlungsmethoden bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit bekannter machen und in enger Zusammenarbeit mit der ambulanten Versorgung diagnostische und therapeutische Defizite beheben. Die Psychiatrische Klinik der FU ist eines der wesentlichen beteiligten Forschungszentren in diesem wegweisenden Projekt.
Depressiv erkrankte Patienten, die sich in stationärer Behandlung der beteiligten Kliniken befinden, können in die Algorithmusstudie aufgenommen werden. Für Studienpatienten gibt es eine intensive Begleitung durch Studienärzte und -psychologen sowie regelmäßige Nachuntersuchungen in Absprache mit dem niedergelassenen Arzt. Erteilt ein Patient hierzu seine Zustimmung, so kann er sich am UKBF auch an anderen Projekten des Kompetenznetzes Depression beteiligen, die sich allesamt der Verbesserung von Erkennung und Behandlung depressiver Erkrankungen gewidmet haben. Hierzu gehören zum Beispiel die Untersuchung des Einflusses von Lebensumständen und Besonderheiten der Symptomatik auf die kurz- und langfristige Prognose, Möglichkeiten frühzeitiger Rezidiverkennung, aber auch biologischer Faktoren wie die Besonderheiten des Stresshormonhaushaltes.
Wenn Menschen mit Depressionen nach einem wissenschaftlich fundierten "Stufenplan" behandelt werden, sind die Erfolgsaussichten deutlich größer. Dies zeigen die soeben ausgewerteten Daten einer zwischen 1997 und 2000 vorgenommenen Untersuchung, der "BERLINER STUFENPLANSTUDIE" am Fachbereich Humanmedizin der FU/Universitätsklinikum Benjamin Franklin (UKBF). Während bei körperlichen Erkrankungen Leitlinien längst akzeptiert sind, waren bei psychischen Krankheiten die Effekte einer systematischen Therapie bisher kaum untersucht. Die Arbeitsgruppe um Dr. Mazda ADLI und Dr. Dr. Michael Bauer von der Psychiatrischen Klinik (Leitung: Prof. Isabella Heuser) der Freien Universität Berlin hat nun die streng leitliniengetreue Therapie der Depression mit der üblichen Behandlung nach individuellem ärztlichen Ermessen verglichen. Die Ergebnisse: weniger chronifizierte Krankheitsverläufe, weniger Medikamente, kürzere Krankenhausaufenthalte.
Dem "Berliner Stufenplan" liegt ein Algorithmus - ein Entscheidungsbaum - zugrunde, der je nach Ansprechen eines Patienten im 14-tägigen Rhythmus das weitere Vorgehen vorschreibt. Das Prinzip ist einfach: Führt die 1. Stufe des Behandlungsplanes im vorgesehenen Zeitraum nicht zum erwünschten Erfolg, wird die 2. Stufe der Therapie beschritten - und so weiter.
Die Patienten in der Stufenplangruppe zeigten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, im Beobachtungszeitraum zu genesen wie die "individuell" behandelten Patienten. Nach Stufenplan therapierte Patienten mussten im Schnitt 18 Tagen kürzer behandelt und konnten zehn Tage früher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Während nach sieben Behandlungswochen die Hälfte der nach Stufenplan behandelten Patienten weitgehend beschwerdefrei war, wurde diese Rate bei nach individuellem Zuschnitt behandelten Patienten erst nach zwölf Wochen erreicht. Die "Stufenplan-Patienten" brauchten ferner nicht nur weniger Medikamente, sondern auch weniger Therapiewechsel. Mit anderen Worten: Die systematisierte Behandlung senkt nicht nur Kosten, sondern kann auch zu einer schonenderen und möglicherweise nebenwirkungsärmeren Therapie führen.
Trotz besserer Medikamente hatte die Depressionsbehandlung in den letzten Jahren stagniert. Die führenden europäischen und amerikanischen Depressionsforscher hatten wiederholt gefordert, leitlinienorietierte Therapien auf den Prüfstand zu stellen. Nach ihren bisherigen, ermutigenden Ergebnissen will die Berliner Gruppe nun ihre Erfahrungen in einer bundesweit angelegten Studie auf noch breitere Basis stellen. Das Projekt wird im Rahmen des Kompetenznetzes Depression als "Algorithmusstudie" realisiert. 450 Patienten sollen, über die Republik verteilt, in die Untersuchung aufgenommen werden. Die Studie prüft auch ein computergestütztes Therapiesystem, das dem behandelnden Arzt in regelmäßigen Abständen eine leitlinienorientierte Entscheidungshilfe anbietet. Viele niedergelassene Ärzte wünschen seit langem eine solche Unterstützung bei der medikamentösen Depressionsbehandlung. Dabei ist selbstverständlich die Psychotherapie integraler Bestandteil.
Das Kompetenznetz Depression will die Krankheit, ihre Symptome und Behandlungsmethoden bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit bekannter machen und in enger Zusammenarbeit mit der ambulanten Versorgung diagnostische und therapeutische Defizite beheben. Die Psychiatrische Klinik der FU ist eines der wesentlichen beteiligten Forschungszentren in diesem wegweisenden Projekt.
Depressiv erkrankte Patienten, die sich in stationärer Behandlung der beteiligten Kliniken befinden, können in die Algorithmusstudie aufgenommen werden. Für Studienpatienten gibt es eine intensive Begleitung durch Studienärzte und -psychologen sowie regelmäßige Nachuntersuchungen in Absprache mit dem niedergelassenen Arzt. Erteilt ein Patient hierzu seine Zustimmung, so kann er sich am UKBF auch an anderen Projekten des Kompetenznetzes Depression beteiligen, die sich allesamt der Verbesserung von Erkennung und Behandlung depressiver Erkrankungen gewidmet haben. Hierzu gehören zum Beispiel die Untersuchung des Einflusses von Lebensumständen und Besonderheiten der Symptomatik auf die kurz- und langfristige Prognose, Möglichkeiten frühzeitiger Rezidiverkennung, aber auch biologischer Faktoren wie die Besonderheiten des Stresshormonhaushaltes.
Analyse
"Die Struktur- und Transaktions-Analyse, die anhand fundierter klinischer Beobachtungen entstanden sind, stellen eine systematische und konsistente Theorie der Persönlichkeit und der sozialdynamischen Prozesse dar. Sie bieten eine handlungsorientierte, rationale Therapieform, die sich für die Mehrzahl der psychiatrischen Patienten eignet, für sie leicht nachvollziehbar ist und sich an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen läßt.
Die bisherigen Psychotherapierichtungen lassen sich grob in zwei Klassen unterteilen: Solche, die Suggestion, Beruhigung, Bestätigung und andere »elterliche« Funktionen berücksichtigen, und jene mit »rationalem« Ansatz, die auf Konfrontation und Deutung basieren, wie zum Beispiel die nicht-kreative Therapie und die Psychoanalyse. Die »elterlichen« Zugänge haben den Nachteil, die infantilen Phantasien des Patienten zu übersehen oder sich darüber hinwegzusetzen. Damit büßt der Therapeut langfristig allzu leicht die Führungskompetenz beim therapeutischen Geschehen ein und ist beim Abschluß der Behandlung von den Ergebnissen überrascht oder enttäuscht. Therapieformen, die den Zugang zur Person über die Ratio suchen, streben die gefestigte innere Kontrolle beim Patienten an. Mit den herkömmlichen Methoden kann das viel Zeit in Anspruch nehmen.
Der strukturell-transaktionale Ansatz verhilft dazu, die oben genannten Schwierigkeiten zu überwinden. Da der Patient mit dieser Methode schnell lernt, seine Ängste zu tolerieren und zu kontrollieren und sein Agieren einzuschränken, hat sie viele Vorteile der »elterlichen« Therapie. Gleichzeitig bleiben die Vorteile der rationalen Therapie bewahrt, da der Therapeut sich der infantilen Elemente in der Persönlichkeit des Patienten völlig bewußt bleibt. Der Ansatz hat sich in den Fällen als besonders wertvoll erwiesen, wo es notorisch schwierig ist, herkömmliche Therapie effektiv anzuwenden. Diese Fälle schließen Persönlichkeitsstörungen der verschiedenen Typen ein: latente, remittente und borderline Schizophrene und Manisch-Depressive sowie geistig zurückgebliebene Erwachsene."
"Die Struktur- und Transaktions-Analyse, die anhand fundierter klinischer Beobachtungen entstanden sind, stellen eine systematische und konsistente Theorie der Persönlichkeit und der sozialdynamischen Prozesse dar. Sie bieten eine handlungsorientierte, rationale Therapieform, die sich für die Mehrzahl der psychiatrischen Patienten eignet, für sie leicht nachvollziehbar ist und sich an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen läßt.
Die bisherigen Psychotherapierichtungen lassen sich grob in zwei Klassen unterteilen: Solche, die Suggestion, Beruhigung, Bestätigung und andere »elterliche« Funktionen berücksichtigen, und jene mit »rationalem« Ansatz, die auf Konfrontation und Deutung basieren, wie zum Beispiel die nicht-kreative Therapie und die Psychoanalyse. Die »elterlichen« Zugänge haben den Nachteil, die infantilen Phantasien des Patienten zu übersehen oder sich darüber hinwegzusetzen. Damit büßt der Therapeut langfristig allzu leicht die Führungskompetenz beim therapeutischen Geschehen ein und ist beim Abschluß der Behandlung von den Ergebnissen überrascht oder enttäuscht. Therapieformen, die den Zugang zur Person über die Ratio suchen, streben die gefestigte innere Kontrolle beim Patienten an. Mit den herkömmlichen Methoden kann das viel Zeit in Anspruch nehmen.
Der strukturell-transaktionale Ansatz verhilft dazu, die oben genannten Schwierigkeiten zu überwinden. Da der Patient mit dieser Methode schnell lernt, seine Ängste zu tolerieren und zu kontrollieren und sein Agieren einzuschränken, hat sie viele Vorteile der »elterlichen« Therapie. Gleichzeitig bleiben die Vorteile der rationalen Therapie bewahrt, da der Therapeut sich der infantilen Elemente in der Persönlichkeit des Patienten völlig bewußt bleibt. Der Ansatz hat sich in den Fällen als besonders wertvoll erwiesen, wo es notorisch schwierig ist, herkömmliche Therapie effektiv anzuwenden. Diese Fälle schließen Persönlichkeitsstörungen der verschiedenen Typen ein: latente, remittente und borderline Schizophrene und Manisch-Depressive sowie geistig zurückgebliebene Erwachsene."
Um abzunehmen brauchst du eine negative kcal-Bilanz. Dann wird Depotfett verwendet, um wichtige Vorgänge im Körper zu erhalten. Wenn du allerdings dein Training vernachlässigst oder Eiweissmangel hast, kann es passieren das du auch Muskeln abbaust. Das effektivste Training ist sehr intensives Krafttraining, da der Nachbrenneffekt viel effektiver ist als bei Ausdauertraining. Wenn du allerdings schon länger in deiner Diät bist, dann solltest du alles tun, um deinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen, den der Körper reagiert auf eine lange "Hungerperiode" indem er den Stoffwechsel auf ein Minimum herunterfährt. Was ich gerade nach gelesen hab, gut zum abnehmen:
-viel kaltes Wasser, da es den stoffwechsel anregt (bei viel Wasser) und der Körper Energie benötigt, um es auf Körpertemperatur zu bringen (deswegen kalt)
-zuckerfreier Kaugummi (Die Kaubewegung ist schließlich auch eine Bewegung, und Schaden tut es auf keinen Fall)
Wenn du wirklich was erreichen willst, dann ist dieses Forum aber leider als Informationsquelle schlecht geeignet. (Ich hab selber einen Thread im gleichen Forum, nicht zu verfehlen, deswegen weiss ich, wie schön das ist, wenn alle sagen, mach doch weiter wie bisher blablabla ^^)
Geh mal in das www.ironsport.de Forum, aber bitte nicht gleich losschreiben, sondern erstmal die Suchfunktion benutzen.
-viel kaltes Wasser, da es den stoffwechsel anregt (bei viel Wasser) und der Körper Energie benötigt, um es auf Körpertemperatur zu bringen (deswegen kalt)
-zuckerfreier Kaugummi (Die Kaubewegung ist schließlich auch eine Bewegung, und Schaden tut es auf keinen Fall)
Wenn du wirklich was erreichen willst, dann ist dieses Forum aber leider als Informationsquelle schlecht geeignet. (Ich hab selber einen Thread im gleichen Forum, nicht zu verfehlen, deswegen weiss ich, wie schön das ist, wenn alle sagen, mach doch weiter wie bisher blablabla ^^)
Geh mal in das www.ironsport.de Forum, aber bitte nicht gleich losschreiben, sondern erstmal die Suchfunktion benutzen.
Liebe Marion.....
.... ärgere dich nicht allzusehr darüber. So ein Mensch wie Aurenia ist bedauernswert. Für mich macht es den Eindruck, dass sie sich und ihr Leben überhaupt nicht im Griff hat und den Begriff "Lebensqualität" wahrscheinlich niemals richtig interpretieren wird....
Schönen sonnigen Tag für dich und ganz liebe Grüße
Anschi
.... ärgere dich nicht allzusehr darüber. So ein Mensch wie Aurenia ist bedauernswert. Für mich macht es den Eindruck, dass sie sich und ihr Leben überhaupt nicht im Griff hat und den Begriff "Lebensqualität" wahrscheinlich niemals richtig interpretieren wird....
Schönen sonnigen Tag für dich und ganz liebe Grüße
Anschi
Fettbauch kann schrecklich sein!
also ich kenn auch einen, der hat in 6 Monaten viel abgenommen, ist schlank, hat aber eine richtige fettkugel "als Bauch", der leidet echt!! und nach seinen erzählungen, hat er meines Erachtens die kalorienzufuhr zu sehr gedrosselt und kein effizientes krafttraining gemacht...
also ich kenn auch einen, der hat in 6 Monaten viel abgenommen, ist schlank, hat aber eine richtige fettkugel "als Bauch", der leidet echt!! und nach seinen erzählungen, hat er meines Erachtens die kalorienzufuhr zu sehr gedrosselt und kein effizientes krafttraining gemacht...
Najo...
zitat: "aber bitte nicht gleich losschreiben, sondern erstmal die Suchfunktion benutzen"
Das hättest du auch tun sollen. Alles was nach "Was ich gerade gelesen hab" solltest du schnellstens wieder vergessen.
http://static.orf.at/community/user/2002-43/3380.gif
zitat: "aber bitte nicht gleich losschreiben, sondern erstmal die Suchfunktion benutzen"
Das hättest du auch tun sollen. Alles was nach "Was ich gerade gelesen hab" solltest du schnellstens wieder vergessen.
http://static.orf.at/community/user/2002-43/3380.gif
donny1
New member
den unsinn hast du aber sicher nicht vom ironsport forum oder?In Antwort auf:
-viel kaltes Wasser, da es den stoffwechsel anregt (bei viel Wasser) und der Körper Energie benötigt, um es auf Körpertemperatur zu bringen (deswegen kalt)
-zuckerfreier Kaugummi (Die Kaubewegung ist schließlich auch eine Bewegung, und Schaden tut es auf keinen Fall)
denn sowas wird dort nicht geschrieben!!
http://www.ironsport.de/forum/images/avatars/13152477623f9fc19660b08.jpg
kurt1
New member
das viszerale Fett...
...schwindet als erstes, wenn die e-bilanz negativ ist, genauso wie es bei einer pos. e-bilanz als erstes gespeichert wird. ich hab schon wiederholt erklärt, das das viszerale fettgewebe am stoffwechselaktivsten ist, sprich stoffwechselaktiver als das subcutane fettgewebe.
gruß, kurt
...schwindet als erstes, wenn die e-bilanz negativ ist, genauso wie es bei einer pos. e-bilanz als erstes gespeichert wird. ich hab schon wiederholt erklärt, das das viszerale fettgewebe am stoffwechselaktivsten ist, sprich stoffwechselaktiver als das subcutane fettgewebe.
gruß, kurt
kurt1
New member
"große Töne" eines Neulings
das einzig vernünftige, was du hier von dir gegeben hast, ist das mit der negativen energiebilanz und dem nachbrenneffekt durch krafttraining. das ist übrigens die "botschaft", die dieses forum vermittelt. bevor du also ein bodybuilding (!)-forum empfiehlst und dieses forum voreilig als informationsquelle abqualifizierst, solltest du dich mal ein wenig im forenarchiv umsehen, und ganz allgemein das, was du so liest, künftig kritischer evaluieren.
gruß, kurt
das einzig vernünftige, was du hier von dir gegeben hast, ist das mit der negativen energiebilanz und dem nachbrenneffekt durch krafttraining. das ist übrigens die "botschaft", die dieses forum vermittelt. bevor du also ein bodybuilding (!)-forum empfiehlst und dieses forum voreilig als informationsquelle abqualifizierst, solltest du dich mal ein wenig im forenarchiv umsehen, und ganz allgemein das, was du so liest, künftig kritischer evaluieren.
gruß, kurt
kurt1
New member
Ergänzung zu den anderen Antworten
nein, es kann nicht sein, dass bauchmuskeln den bauch "nach außen drücken". eine "halbkugel", auch "bierbauch" genannt (obwohl er nicht direkt mit bierkonsum zu tun hat), ist durch eine viszerale adipositas bedingt.
allgemeiner tipp
siehe auch mein aktuelles posting weiter oben "nochmals komplexe fragen u. antworten..."
gruß, kurt
nein, es kann nicht sein, dass bauchmuskeln den bauch "nach außen drücken". eine "halbkugel", auch "bierbauch" genannt (obwohl er nicht direkt mit bierkonsum zu tun hat), ist durch eine viszerale adipositas bedingt.
allgemeiner tipp
siehe auch mein aktuelles posting weiter oben "nochmals komplexe fragen u. antworten..."
gruß, kurt
A
Anzeige
schau mal hier:
Komplexe Frage zum Abnehmen .