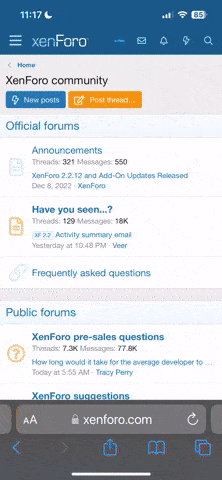Re: Atkins/Low-Carb
Sehr geehrter Herr Dr. Moosburger,
ich habe mich zu Wort gemeldet, nachdem ein Forums-Teilnehmer mich auf die Diskreditierung meiner Person durch Sie am 07 Juni aufmerksam gemacht hatte („...einer von denen, die auf den "Atkins"-Zug aufgesprungen sind, was alles andere als originell ist. ich hab die nase voll von diesen Pseudoexperten (atkins, lutz, worms usw.), die wissenschaftlich überhaupt nichts bewiesen haben und auch nichts beweisen können. und wenn du glaubst, Worms & Co würden den "state of the art" vertreten, bist du naiv. sie sind nichts als blender, die weder den intermediärstoffwechsel des Menschen verstanden haben noch Humanethologisch qualifiziert sind!“)
Nun schreiben Sie nach einigen Tagen an mich: „Fazit: Unsere Statements sind weniger diametral, als sie meinen...“ Wenn das nicht schon mal eine erfreuliche Entwicklung darstellt, die möglicherweise für Ihre Foren-Teilnehmer auch ganz interessant sein könnte...
Ich habe übrigens auch nie behauptet, dass meine Empfehlungen zur Atkins bzw. Low-Carb-Diäten „evidenz-basierten“ Kriterien entsprechen – ich mein natürlich hinsichtlich klinisch relevanter, „harter“ Endpunkte! Wo haben Sie das her? Welche etablierte Ernährungsregel hinsichtlich solcher Endpunkte entspricht überhaupt den Kriterien von EBM (außer n-3 in der Sekundär-Prävention der KHK)? Was oder wer ist „State of the Art“? Die Empfehlungen von Ernährungsfachgesellschaften, die nach EBM die niedrigste Aussagefähigkeit bzw. Evidenz bieten? Die Statements von Herrn Elmadfa? Ihre? Und wie kommen Sie neuerlich zu dieser Behauptung: „...wenn sie schon ernährungsmedizinern, lipidologen und diabetologen die kompetenz absprechen, die sie sich zusprechen ...“ Woher haben Sie diese Info?
Ich stellte jedenfalls fest, dass Sie sich auch noch Anfang Juni eindeutig negativ zur Atkins-Diät geäußert haben, ohne Ihre Foren-Teilnehmer auch nur annähernd über die interessanten und vor allem günstigen Ergebnisse der 5 neuen, nun endlich methodisch entsprechend anspruchsvollen Studien zu dieser Ernährungsform informiert zu haben. Warum eigentlich nicht?
Dafür unterstellen Sie mir wiederum den "metabolischen Denkfehler“, ich würde die Hemmung der Lipolyse mit einer Hemmung der Betaoxidation gleichsetzen. („..das sind zwei verschiedene paar schuhe. dass eine der insulinwirkungen die hemmung der lipolyse ist, lernt man schon als medizinstudent. aber die betaoxidation ist davon nicht betroffen..).
Nun gab ich ja meine Literaturquellen eigentlich mit der Hoffnung an, damit etwas bewirken zu können – im Zweifelsfalle Ihre eigenhändige Überprüfung Ihrer Aussagen. Ich darf vielleicht nochmals aus der bereits zitierten Arbeit von Rasmussen et al. diesmal wörtlich zitieren (1):
„...In summary, we have demonstrated that during physiological hyper-glycemia with hyperinsulinemia and maintained FFA concentrations (i.e., a condition that mimicsthe insulin-resistant state), human skeletal muscle malonyl-CoA concentrations are significantly increased and are directly as-sociated with a reduction in LCFA oxidation and functional CPT-1 activity. Also, LCFA uptake is not altered during these conditions, leading to a shunting of LCFA away from oxidation and toward reesterification and storage as intramuscular triglyceride....“
Dazu hatte ich auch noch ein interessantes Editorial von Jensen zitiert, das die Erkenntnisse von Rasmussen et al. ausführlich würdigt und mit den Worten kommentiert (2): „In this issue of the JCI, Rasmussen et al. describe the functional regulation of fatty acid oxidation by hyperglycemia and hyperinsulinemia in human skeletal muscle....“
Vielleicht motiviert Sie dies nun doch einmal, sich mit dem Thema neu zu beschäftigen und vor allem die Forums-Teilnehmer über die neuen Erkenntnisse zu informieren....
Ihre wiederholt dargelegte Meinung, eine fettreiche Kostform würde bei Patienten mit Hypertriglyceridämie die metabolische Situation nur noch verschlechtern („...abgesehen davon scheinen sie die metabolische tatsache zu ignorieren, dass gerade beim metabolischen syndrom - trotz hyperinsulinämie! - eine sehr aktive lipolyse im viszeralen fettgewebe besteht und die dadurch vermehrt anfallenden freien fettsäuren den lipidstatus hypertriglyceridämie usw. verschlechtern...“) kann ich nicht nachvollziehen. Nach meiner und der Erfahrung vieler Kollegen ist dies üblicherweise die einfachste Übung bei entsprechenden Patienten mit IGT bzw. Insulinresistenz: Eine Senkung des Kohlenhydratanteils und ein entsprechendes Anheben des Eiweiß- bzw. Fettanteils (oder noch besser beides in Kombination) senkt die Triglyceride schnell und deutlich – mit und ohne gleichzeitiger Gewichtsreduktion. Ich lege Ihnen dazu einige aktuellen Literaturstellen ans Herz (3-5).
Zu Volker Pudel und dessen "500g-Grenze" der KH-Zufuhr hinsichtlich der de novo-Lipogenese kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist absurd und neue Arbeiten weisen darauf hin, dass sogar ausgerechnet die Dicksten schon bei „normalen“ KH-Mengen eine deutlich gesteigerte Fettsynthese aufweisen, wobei ausgerechnet vornehmlich die Palmitinsäure gebildet wird, vor der wegen ihrer LDL-steigernden Wirkung ständig gewarnt wird (6, 7). Im Übrigen habe ich schon häufiger mit Pudel vor Publikum auf Diskussionsforen gestritten. Seine „Fett macht fett“ bzw. „fettarm macht schlank“ ist problemlos mit alten und neuen Daten zu widerlegen, was ich kürzlich auch in Form eines Fachartikels getan habe (8). In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch noch dringend den hervorragenden Diskussionsteil einer tierexperimentellen Arbeit empfehlen (9). Ich kann Ihnen, wenn Sie möchten und Sie mir eine email schicken, gerne auch all diese Arbeiten als pdf zur Verfügung stellen.
Was die von mir angesprochene "reaktive Hypoglykämie" betrifft, so haben Sie sicherlich recht, dass es diese nicht definitionsgerecht wirklich gibt. Gemeint war, dass der Blutzucker nach hohem Blutzuckeranstieg stark fällt und dann typischerweise niedriger ist als vorher im Nüchternzustand und dass dies der adäquate Reiz dafür ist, wieder Nahrung aufzunehmen und damit ein Risiko für Überernährung darstellt. Auch hierzu würde ich Ihnen gerne aktuelle Literatur empfehlen (10, 11).
Schließlich darf ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass Ihre ständig wiederholte Aussagen, Ernährungsformen mit niedriger Kohlenhydratzufuhr oder niedrigem Glykämsichem Index seien nur für bereits Erkrankte relevant, schlichtweg unverantwortlich sind. Es gibt tatsächlich reihenweise sehr ernst zu nehmende Hinweise aus der Epidemiologie, dass eine Ernährung mit hoher Glykämischer Last bzw. hohem Glykämischem Index ein Risiko für die Entwicklung von T2-Diabetes mellitus, KHK und bestimmten Krebsformen ist und folglich entsprechende Ernährungsmodifikationen für die Primärprävention von hoher Relevanz sein könnten (12-16).
Im Übrigen möchte ich abschließend noch bemerken, dass ich über Ihre herablassende Wortwahl und Ihre unreflektierten Unterstellungen – ohne meine Person und Tätigkeiten auch nur annähernd beurteilen zu können - einigermaßen erstaunt bin. Ich dachte bislang immer, dass solche Internet-Diskussionsforen dem informellen Info- und Meinungsaustausch dienen. Ihre Einlassungen verströmen hingegen eine selbstherrliche und dogmatische Attitüde der Unfehlbarkeit, was ich als ziemlich unerträglich empfinde. Das werde ich mir in Zukunft einfach sparen. Ich denke, Sie werden mir nicht nachtrauern.
Mir freundlichen Grüssen,
Nicolai Worm
Literatur:
1. Rasmussen BB, Holmback UC, Volpi E, Morio-Liondore B, Paddon-Jones D, Wolfe RR. Malonyl coenzyme A and the regulation of functional carnitine pal-mitoyltransferase-1 activity and fat oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1687-1693.
2. Jensen MD. Fatty acid oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1607-9.
3. Pieke B, von Eckardstein A, Gulbahce E, et al. Treatment of hypertriglyceri-demia by two diets rich either in unsaturated fatty acids or in carbohydrates: effects on lipoprotein subclasses, lipolytic enzymes, lipid transfer proteins, in-sulin and leptin. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1286-96.
4. Farnsworth E, Luscombe ND, Noakes M, Wittert G, Argyiou E, Clifton PM. Ef-fect of a high-protein, energy-restricted diet on body composition, glycemic control, and lipid concentrations in overweight and obese hyperinsulinemic men and women. Am J Clin Nutr 2003;78:31-9.
5. Wolever TM, Mehling C. Long-term effect of varying the source or amount of dietary carbohydrate on postprandial plasma glucose, insulin, triacylglycerol, and free fatty acid concentrations in subjects with impaired glucose tolerance. Am J Clin Nutr 2003;77:612-21.
6. Marques-Lopes I, Ansorena D, Astiasaran I, Forga L, Martinez JA. Postpran-dial de novo lipogenesis and metabolic changes induced by a high-carbohydrate, low-fat meal in lean and overweight men. Am J Clin Nutr 2001;73:253-61.
7. Schwarz JM, Linfoot P, Dare D, Aghajanian K. Hepatic de novo lipogenesis in normoinsulinemic and hyperinsulinemic subjects consuming high-fat, low-carbohydrate and low-fat, high-carbohydrate isoenergetic diets. Am J Clin Nutr 2003;77:43-50.
8. Worm N. Macht Fett fett und fettarm schlank? DMW 2002;127:2743-2747.
9. Morris KL, Namey TC, Zemel MB. Effects of dietary carbohydrate on the de-velopment of obesity in heterozygous Zucker rats. J Nutr Biochem 2003;14:32-39.
10. Layman DK. The Role of Leucine in Weight Loss Diets and Glucose Home-ostasis. J Nutr 2003;133:261S-267S.
11. Ludwig DS. Dietary glycemic index and the regulation of body weight. Lipids 2003;38:117-21.
12. Willett W, Manson J, Liu S. Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2002;76:274S-80S.
13. Liu S, Willett WC. Dietary glycemic load and atherothrombotic risk. Curr Athe-roscler Rep 2002;4:454-61.
14. Tavani A, Bosetti C, Negri E, Augustin LS, Jenkins DJ, La Vecchia C. Carbo-hydrates, dietary glycaemic load and glycaemic index, and risk of acute myo-cardial infarction. Heart 2003;89:722-6.
15. Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJ, Kendall CW, La Vecchia C. Glycemic index in chronic disease: a review. Eur J Clin Nutr 2002;56:1049-71.
16. Michaud DS, Liu S, Giovannucci E, Willett WC, Colditz GA, Fuchs CS. Dietary sugar, glycemic load, and pancreatic cancer risk in a prospective study. J Natl Cancer Inst 2002;94:1293-300.
Sehr geehrter Herr Dr. Moosburger,
ich habe mich zu Wort gemeldet, nachdem ein Forums-Teilnehmer mich auf die Diskreditierung meiner Person durch Sie am 07 Juni aufmerksam gemacht hatte („...einer von denen, die auf den "Atkins"-Zug aufgesprungen sind, was alles andere als originell ist. ich hab die nase voll von diesen Pseudoexperten (atkins, lutz, worms usw.), die wissenschaftlich überhaupt nichts bewiesen haben und auch nichts beweisen können. und wenn du glaubst, Worms & Co würden den "state of the art" vertreten, bist du naiv. sie sind nichts als blender, die weder den intermediärstoffwechsel des Menschen verstanden haben noch Humanethologisch qualifiziert sind!“)
Nun schreiben Sie nach einigen Tagen an mich: „Fazit: Unsere Statements sind weniger diametral, als sie meinen...“ Wenn das nicht schon mal eine erfreuliche Entwicklung darstellt, die möglicherweise für Ihre Foren-Teilnehmer auch ganz interessant sein könnte...
Ich habe übrigens auch nie behauptet, dass meine Empfehlungen zur Atkins bzw. Low-Carb-Diäten „evidenz-basierten“ Kriterien entsprechen – ich mein natürlich hinsichtlich klinisch relevanter, „harter“ Endpunkte! Wo haben Sie das her? Welche etablierte Ernährungsregel hinsichtlich solcher Endpunkte entspricht überhaupt den Kriterien von EBM (außer n-3 in der Sekundär-Prävention der KHK)? Was oder wer ist „State of the Art“? Die Empfehlungen von Ernährungsfachgesellschaften, die nach EBM die niedrigste Aussagefähigkeit bzw. Evidenz bieten? Die Statements von Herrn Elmadfa? Ihre? Und wie kommen Sie neuerlich zu dieser Behauptung: „...wenn sie schon ernährungsmedizinern, lipidologen und diabetologen die kompetenz absprechen, die sie sich zusprechen ...“ Woher haben Sie diese Info?
Ich stellte jedenfalls fest, dass Sie sich auch noch Anfang Juni eindeutig negativ zur Atkins-Diät geäußert haben, ohne Ihre Foren-Teilnehmer auch nur annähernd über die interessanten und vor allem günstigen Ergebnisse der 5 neuen, nun endlich methodisch entsprechend anspruchsvollen Studien zu dieser Ernährungsform informiert zu haben. Warum eigentlich nicht?
Dafür unterstellen Sie mir wiederum den "metabolischen Denkfehler“, ich würde die Hemmung der Lipolyse mit einer Hemmung der Betaoxidation gleichsetzen. („..das sind zwei verschiedene paar schuhe. dass eine der insulinwirkungen die hemmung der lipolyse ist, lernt man schon als medizinstudent. aber die betaoxidation ist davon nicht betroffen..).
Nun gab ich ja meine Literaturquellen eigentlich mit der Hoffnung an, damit etwas bewirken zu können – im Zweifelsfalle Ihre eigenhändige Überprüfung Ihrer Aussagen. Ich darf vielleicht nochmals aus der bereits zitierten Arbeit von Rasmussen et al. diesmal wörtlich zitieren (1):
„...In summary, we have demonstrated that during physiological hyper-glycemia with hyperinsulinemia and maintained FFA concentrations (i.e., a condition that mimicsthe insulin-resistant state), human skeletal muscle malonyl-CoA concentrations are significantly increased and are directly as-sociated with a reduction in LCFA oxidation and functional CPT-1 activity. Also, LCFA uptake is not altered during these conditions, leading to a shunting of LCFA away from oxidation and toward reesterification and storage as intramuscular triglyceride....“
Dazu hatte ich auch noch ein interessantes Editorial von Jensen zitiert, das die Erkenntnisse von Rasmussen et al. ausführlich würdigt und mit den Worten kommentiert (2): „In this issue of the JCI, Rasmussen et al. describe the functional regulation of fatty acid oxidation by hyperglycemia and hyperinsulinemia in human skeletal muscle....“
Vielleicht motiviert Sie dies nun doch einmal, sich mit dem Thema neu zu beschäftigen und vor allem die Forums-Teilnehmer über die neuen Erkenntnisse zu informieren....
Ihre wiederholt dargelegte Meinung, eine fettreiche Kostform würde bei Patienten mit Hypertriglyceridämie die metabolische Situation nur noch verschlechtern („...abgesehen davon scheinen sie die metabolische tatsache zu ignorieren, dass gerade beim metabolischen syndrom - trotz hyperinsulinämie! - eine sehr aktive lipolyse im viszeralen fettgewebe besteht und die dadurch vermehrt anfallenden freien fettsäuren den lipidstatus hypertriglyceridämie usw. verschlechtern...“) kann ich nicht nachvollziehen. Nach meiner und der Erfahrung vieler Kollegen ist dies üblicherweise die einfachste Übung bei entsprechenden Patienten mit IGT bzw. Insulinresistenz: Eine Senkung des Kohlenhydratanteils und ein entsprechendes Anheben des Eiweiß- bzw. Fettanteils (oder noch besser beides in Kombination) senkt die Triglyceride schnell und deutlich – mit und ohne gleichzeitiger Gewichtsreduktion. Ich lege Ihnen dazu einige aktuellen Literaturstellen ans Herz (3-5).
Zu Volker Pudel und dessen "500g-Grenze" der KH-Zufuhr hinsichtlich der de novo-Lipogenese kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist absurd und neue Arbeiten weisen darauf hin, dass sogar ausgerechnet die Dicksten schon bei „normalen“ KH-Mengen eine deutlich gesteigerte Fettsynthese aufweisen, wobei ausgerechnet vornehmlich die Palmitinsäure gebildet wird, vor der wegen ihrer LDL-steigernden Wirkung ständig gewarnt wird (6, 7). Im Übrigen habe ich schon häufiger mit Pudel vor Publikum auf Diskussionsforen gestritten. Seine „Fett macht fett“ bzw. „fettarm macht schlank“ ist problemlos mit alten und neuen Daten zu widerlegen, was ich kürzlich auch in Form eines Fachartikels getan habe (8). In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch noch dringend den hervorragenden Diskussionsteil einer tierexperimentellen Arbeit empfehlen (9). Ich kann Ihnen, wenn Sie möchten und Sie mir eine email schicken, gerne auch all diese Arbeiten als pdf zur Verfügung stellen.
Was die von mir angesprochene "reaktive Hypoglykämie" betrifft, so haben Sie sicherlich recht, dass es diese nicht definitionsgerecht wirklich gibt. Gemeint war, dass der Blutzucker nach hohem Blutzuckeranstieg stark fällt und dann typischerweise niedriger ist als vorher im Nüchternzustand und dass dies der adäquate Reiz dafür ist, wieder Nahrung aufzunehmen und damit ein Risiko für Überernährung darstellt. Auch hierzu würde ich Ihnen gerne aktuelle Literatur empfehlen (10, 11).
Schließlich darf ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass Ihre ständig wiederholte Aussagen, Ernährungsformen mit niedriger Kohlenhydratzufuhr oder niedrigem Glykämsichem Index seien nur für bereits Erkrankte relevant, schlichtweg unverantwortlich sind. Es gibt tatsächlich reihenweise sehr ernst zu nehmende Hinweise aus der Epidemiologie, dass eine Ernährung mit hoher Glykämischer Last bzw. hohem Glykämischem Index ein Risiko für die Entwicklung von T2-Diabetes mellitus, KHK und bestimmten Krebsformen ist und folglich entsprechende Ernährungsmodifikationen für die Primärprävention von hoher Relevanz sein könnten (12-16).
Im Übrigen möchte ich abschließend noch bemerken, dass ich über Ihre herablassende Wortwahl und Ihre unreflektierten Unterstellungen – ohne meine Person und Tätigkeiten auch nur annähernd beurteilen zu können - einigermaßen erstaunt bin. Ich dachte bislang immer, dass solche Internet-Diskussionsforen dem informellen Info- und Meinungsaustausch dienen. Ihre Einlassungen verströmen hingegen eine selbstherrliche und dogmatische Attitüde der Unfehlbarkeit, was ich als ziemlich unerträglich empfinde. Das werde ich mir in Zukunft einfach sparen. Ich denke, Sie werden mir nicht nachtrauern.
Mir freundlichen Grüssen,
Nicolai Worm
Literatur:
1. Rasmussen BB, Holmback UC, Volpi E, Morio-Liondore B, Paddon-Jones D, Wolfe RR. Malonyl coenzyme A and the regulation of functional carnitine pal-mitoyltransferase-1 activity and fat oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1687-1693.
2. Jensen MD. Fatty acid oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1607-9.
3. Pieke B, von Eckardstein A, Gulbahce E, et al. Treatment of hypertriglyceri-demia by two diets rich either in unsaturated fatty acids or in carbohydrates: effects on lipoprotein subclasses, lipolytic enzymes, lipid transfer proteins, in-sulin and leptin. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1286-96.
4. Farnsworth E, Luscombe ND, Noakes M, Wittert G, Argyiou E, Clifton PM. Ef-fect of a high-protein, energy-restricted diet on body composition, glycemic control, and lipid concentrations in overweight and obese hyperinsulinemic men and women. Am J Clin Nutr 2003;78:31-9.
5. Wolever TM, Mehling C. Long-term effect of varying the source or amount of dietary carbohydrate on postprandial plasma glucose, insulin, triacylglycerol, and free fatty acid concentrations in subjects with impaired glucose tolerance. Am J Clin Nutr 2003;77:612-21.
6. Marques-Lopes I, Ansorena D, Astiasaran I, Forga L, Martinez JA. Postpran-dial de novo lipogenesis and metabolic changes induced by a high-carbohydrate, low-fat meal in lean and overweight men. Am J Clin Nutr 2001;73:253-61.
7. Schwarz JM, Linfoot P, Dare D, Aghajanian K. Hepatic de novo lipogenesis in normoinsulinemic and hyperinsulinemic subjects consuming high-fat, low-carbohydrate and low-fat, high-carbohydrate isoenergetic diets. Am J Clin Nutr 2003;77:43-50.
8. Worm N. Macht Fett fett und fettarm schlank? DMW 2002;127:2743-2747.
9. Morris KL, Namey TC, Zemel MB. Effects of dietary carbohydrate on the de-velopment of obesity in heterozygous Zucker rats. J Nutr Biochem 2003;14:32-39.
10. Layman DK. The Role of Leucine in Weight Loss Diets and Glucose Home-ostasis. J Nutr 2003;133:261S-267S.
11. Ludwig DS. Dietary glycemic index and the regulation of body weight. Lipids 2003;38:117-21.
12. Willett W, Manson J, Liu S. Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2002;76:274S-80S.
13. Liu S, Willett WC. Dietary glycemic load and atherothrombotic risk. Curr Athe-roscler Rep 2002;4:454-61.
14. Tavani A, Bosetti C, Negri E, Augustin LS, Jenkins DJ, La Vecchia C. Carbo-hydrates, dietary glycaemic load and glycaemic index, and risk of acute myo-cardial infarction. Heart 2003;89:722-6.
15. Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJ, Kendall CW, La Vecchia C. Glycemic index in chronic disease: a review. Eur J Clin Nutr 2002;56:1049-71.
16. Michaud DS, Liu S, Giovannucci E, Willett WC, Colditz GA, Fuchs CS. Dietary sugar, glycemic load, and pancreatic cancer risk in a prospective study. J Natl Cancer Inst 2002;94:1293-300.