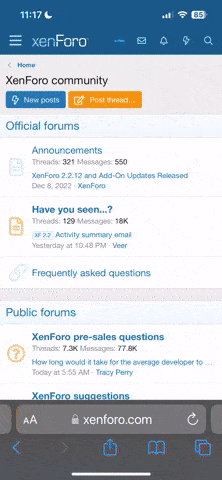Hallo Foren-Doc!
Echter geht es nicht - und so werden wir uns in der Tat am 25.10. sehen und vielleicht auch diskutieren.
Ich bin beruflich viel verreist und komme deshalb leider erst heute zu einer Replik zu Ihrem Kommentar vom 29. Juli.
Zu Ihrem Hinweis, Sie hätten in Bezug auf „Atkins“ im Forum alles wesentliche schon mehrfach erläutert, erlaube ich mir zunächst ganz allgemein anzumerken, dass unzutreffende Äußerungen nicht dadurch richtiger werden, dass man sie häufig wiederholt.
Ganz konkret lassen Ihre Äußerungen eher darauf schließen, dass Sie bislang das Prinzip und die Wirkungsweise kohlenhydratreduzierter Kostformen noch nicht erkennen.
Bei Atkins & Co geht es nicht primär und eine Erhöhung der Fettzufuhr! Das ist ein sekundärer Begleiteffekt. Vielmehr geht es erstens um die Senkung der Kohlenhydrate (KH) – vor allem der mit hohem Glykämischem Index – und zweitens um eine deutliche Anhebung der Zufuhr von Eiweiß.
zu 1.: Die KH-Reduzierung bewirkt eine Stabilisierung der Blutzucker und Insulinspiegel auf niedrigem Niveau, minimiert das Risiko reaktiver Hypoglykämien und dadurch ausgelöste Hunger- und Appetitattacken. Andererseits maximiert eine KH-Einschränkung die Fettoxidation: Jedes KH-reiche Mahl bedingt eine postprandiale Hyperglykämie und Hyperinsulinämie, wodurch in direkter Folge die Fettverbrennung massiv gehemmt wird (1, 2). Eine Störung des Fettstoffwechsels ist die Folge (siehe unten).
zu 2.: Die Eiweißerhöhung fördert die Glukoneogenese vor allem über Nacht, stablisiert also den Blutzuckerspiegel und minimiert die Wahrscheinlichkeit für Hungerattacken – insbesondere für morgendliche (3). Weiterhin garantiert eine hohe Eiweißzufuhr einen starken Sättigungseffekt.
Aber was auch immer noch an physiologischen Zusammenhängen dahinter stehen und welche Theorien man auch sonst noch dazu formulieren mag, entscheidend ist die tatsächliche Wirkung. Die haben Hunderttausende Übergewichtige am eigenen Leib erlebt und nun ist sie auch in entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten dokumentiert: Eine KH-reduzierte Kost à la Atkins & Co führt SPONTAN zu einer Senkung der Energieaufnahme. Die von mir zitierten Studien mit Atkins-Diät sind ja alle „ad libitum“ durchgeführt worden! Die Probanden erhielten keinerlei Kalorienbeschränkung. Sie durften sich immer satt essen. Die Gewichtsabnahme unter Atkins & Co ist also erwiesenermaßen nicht nur effizienter als mit fettreduzierter, KH-reicher Ernährung, sie gelingt noch dazu ohne die üblichen Hungerqualen. Und daneben bewirkt diese KH-reduzierte Diät auch noch ein besseres Risikofaktorprofil, als die fettreduzierte, KH-reiche Kost. Mit weniger radikalen Ernährungsumstellungen, z. B. mit der von mir propagierten LOGI-Methode ist man gleichzeitig auch auf Dauer ohne Risiko für eine Mangelversorgung im Nährstoffbereich und hat keine Säurenbelastung zu befürchten.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht Ihrem und dem Weltbild vieler anderer „Ernährungsexperten“ entspricht, wenn eine Kost, die bis zu 60 % Fett und noch dazu ü-berwiegend tierisches enthält, zu einer deutlich REDUZIERTEN Energieaufnahme beiträgt und damit das Therapieziel „Abnehmen und Normalisierung des entgleisten Stoffwechsels“ besser erreicht wird, als mit der herkömmlich propagierten fettarmen Diät. Aber diese Fakten sind nicht mehr nach dem Motto „was nicht sein darf, kann nicht sein“ weg zu diskutieren. Wer es nicht glaubt, soll einen heroischen Selbstversuch durchführen – das fördert die Akzeptanz ungemein. Jeder kann schnell feststellen, dass die hohe Eiweißzufuhr in Kombination mit der hohen Zufuhr an stärkearmem aber ballaststoffreichem Gemüse und Salat eine ausgeprägte und lang anhaltende Sättigung bewirkt, so dass insgesamt die Energiezufuhr spontan sinkt und man abnimmt. Kohlenhydratreiche Kostformen dagegen, vor allem bei hohem Glykämischem Index, führen dagegen offenbar dazu, dass relativ mehr Hunger- und Appetitsignale entstehen, als an Energie tatsächlich benötigt wird: Sie stören offenbar den physiologisch „gesunden“ Signalstoffwechsel...
Vor den dokumentierten Wirkungen sind entsprechend auch all Ihre theoretischen Ausführungen hinsichtlich der vermeintlichen Risiken durch fettreiche Kostformen („hohe Energiedichte“, „positive Energiebilanz“, „freie Fettsäuren“, „Förderung der In-sulinresistenz“ etc.) - so plausibel sie auch nach herkömmlicher Lehrmeinung anmuten mögen – Makulatur, um nicht zu sagen geradezu grotesk. Die neuen Studien haben ja ausgewiesen, dass mit solch eiweißreichen, KH-reduzierten Diäten insbesondere das viszerale Fett abgebaut wird. Wer abnimmt und noch dazu in hohem Masse das intraabdominale Fett, erfährt eine deutliche Minderung der Insulinresistenz. Sind die dokumentierten gesenkten Nüchtern-Insulinspiegel etwa ein Zeichen von gesteigerten Insulinresistenz? Unzählige Typ 2 Diabetiker haben erlebt, dass unter KH-reduzierten Kostformen die Medikation bzw. die Insulindosis zum Teil dramatisch gesenkt werden muss, um nicht in den Unterzucker zu kommen. Auch dies dürfte ja kaum ein Zeichen von verstärkter Insulinresistenz sein!
Ich teile Ihre Meinung, dass viele Menschen einfach zu viel essen – das heißt mehr als sie brauchen und folglich wegen der positiven Energiebilanz dick und insulinresistent werden. Könnten Sie dann aber bitte einmal erklären, warum Sie mit Vehemenz Menschen davon abbringen wollen, sich auf eine Kostform umzustellen, die ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit eher dazu verhilft, eine ausgewogene Energiebilanz bzw. im Fall von Übergewicht eine negative Energiebilanz zu erreichen, als mit allen anderen Kostformen? Noch dazu wenn dies gleichzeitig auch noch relevante Risikofaktoren günstiger beeinflusst, als mit den herkömmlichen Ernährungsumstellungen. Wie können Sie das eigentlich mit Ihrem ärztlichen Eid („...Schaden vom Patienten abhalten...“) vereinbaren?
Ich hänge unten beispielhaft einen Erfahrungsbericht einer Betroffenen an, der ich empfohlen hatte, zunächst mit Atkins-Diät anzufangen und dann auf die LOGI-Methode umzusteigen. Wer mit der Dame persönlich Kontakt zwecks Erfahrungsaustausch aufnehmen will, soll mich direkt anmailen (nicolai.worm@t-online.de).
Lassen Sie mich auch noch ein paar allgemeine Anmerkungen zu Ihren Thesen machen:
1. Ich kenne keine einzige repräsentative Studie, die einen Fettanteil von 50% der E-nergie in unserer Bevölkerung dokumentierte. Diese von Ihnen immer wieder genannte Zahl ist reine Phantasie. Vielmehr wird in entspechenden wissenschaftichen Bevölkerungsstudien ein Fettkonsum – wie von „calvin“ im Forum bereits korrekt vermerkt – von knapp unter 40% ausgewiesen und er sinkt seit Jahren minimal aber kontinuierlich. Dabei werden die Menschen immer fetter. Das weniger an Fett kompensieren sie durch mehr Kohlenhydrate. Das ist gerade auch wieder an einer Kohorte deutscher Kinder belegt worden (4).
2. Eine kohlenhydratreiche Nahrung bedingt eine postprandiale Hyperglykämie und Hyperinsulinämie, was als direkte Folge die Fettverbrennung massiv hemmt (1, 2). Eine Störung des Fettstoffwechsels ist die Konsequenz. Umgekehrt fördert eine kohlenhydratreduziete Kost die Fettoxidation und eine Verbesserung der Fettstoffwechselwerte [Übersicht in (5)].
Die von Prof. Elmadfa und anderen etablierten Fachleuten empfohlene Senkung der Fettzufuhr von gegenwärtig knapp 40% auf etwa 30 % und entsprechende Anhebung der Kohlenhydrate auf 55% würde zwar zu einer Senkung des LDL-Cholesterins führen, gleichzeitig aber auch zu einer überproportionalen Senkung des HDL-Cholesterins. Damit erreicht man eine Erhöhung des Verhältnisses von Gesamt- bzw. LDL-zu HDL-Cholesterin. Darüber hinaus kommt es zu einem Anstieg des VLDL-Cholesterins und der Triglyceride! Diese Effekte der fettreduzierten, kohlenhydratbetonten Kost sind in Dutzenden von Einzelarbeiten in den letzten Jahrzehnten beschrieben worden. Ich weise ja nicht zufällig in meinen Bücher und Vorträgen seit 15 Jahren schon darauf hin.
Diese unerwünschten Nebenwirkungen sind nun aber im Mai 2003 auch mittels einer Metaanalyse, in der die 60 methodisch besten Stoffwechselstudien der letzten Jahrzehnte eingingen, eindrücklich bestätigt worden (6). Dass diese Ernährungsweise zudem auch noch die Konzentration der besonders atherogenen kleinen dichten LDL-Partikeln erhöht, ist auch schon seit vielen Jahren bekannt (7, 8). Hätten Medikamente solche Reaktionen würde man sie wahrscheinlich wegen Erhöhung des Herzinfarktrisikos verbieten. Hinzu kommt, dass es für diese „fettbewußte Diät“ im Gegensatz zur medikamentösen Therapie mit Statinen keine Evidenz eines präventiven Effekts hinsichtlich klinisch relevanter, „harter“ Endpunkte gibt (9, 10).
Fazit: Die positive Energiebilanz ist die Ursache für Übergewicht. Wenn die meisten Menschen unter einer eiweiß- fett- und ballaststoffreichen, kohlenhydratreduzierten Kost offenbar ihre Energiezufuhr effektiver kontrollieren bzw. bei Übergewicht ohne Hungerqualen dauerhafter senken können, als unter einer kohlenhydratbetonten Kost, dann sollte sie für diese Menschen das Mittel der Wahl sein.
Mit besten Wünschen,
Nicolai
____________________
25.07.2003
Hallo,
hier die versprochene E-Mail wg. der Adresse.
Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie am Telefon eben so "zugelabert" habe, aber Sie können meine Begeisterung sicher nachvollziehen...
Ich sehe DEN Tag als einen meiner glücklichsten an, an dem ich mich entschlossen habe, Sie zu kontaktieren. Vielen Dank noch mal, dass Sie sich die Mühe gemacht haben.
Viele liebe Grüße
Birgit S.
02.07.2003
Guten Morgen Herr Worm,
ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, aber wir haben Anfang April 2003 miteinander telefoniert. Damals habe ich Ihnen mein Leid geklagt wg. meiner schlechten Blutwerte und meines doch recht starken Übergewichts, das ich wg. Rückenprobleme doch etwas reduzieren sollte.
Sie rieten mir seiner Zeit zur Atkins-Diät, a) wg. der Ernährungsumstellung und b) wg. der relativ schnellen Gewichtsabnahme und baten um Rückmeldung, wie es anschlägt und ob ich damit zurecht komme.
Hier nun die versprochene Rückmeldung:
Ende April habe ich mit Low-Carb begonnen, seit dem 7. Mai 2003 mache ich streng die "Atkins-Diät". Bis heute habe ich gute 10 Kilo abgenommen und das Beste: Meine Blutwerte sind wieder im grünen Bereich.
Hier habe ich sie mal aufgelistet:
(Die erste Spalte beschreibt die Werte vom 30. Juni 2003, die zweite die Werte vom 3. März 2003 (die Werte mit dem "+" waren die erhöhten))
30.06.03 03.03.03
Blutsenkung 11/23 6/15
Cholesterin gesamt 168 191
Triglyceride 115 645 +
HDL-Cholesterin 42 46
LDL-Cholesterin 103 Serum lipös
CHOL/HDL 4,0 4,2
C-reakt. Protein <5.0 6,0 +
HbA1-c 4,4
ST3G 0,77 1,82 +
T4 6,6 12,1 +
TSH basal 1,43 1,44
Bei der ersten Blutabnahme wurden noch die Schilddrüsenwerte und Leukozyten und Haemoglobin etc. ausgewertet, aber das war alles nicht auffällig und so wurde dieses mal darauf verzichtet.
Ist das nicht phantastisch???
Beim HDL-Wert steht hinter der 42 ein Minus in meiner Liste, das würde theoretisch heißen, dass der Wert zu niedrig ist, ich habe allerdings im Internet einen anderen Wert gefunden und nach diesem wäre mein Wert im Okay-Bereich. Was stimmt denn nun?
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich noch mal bei mir melden würden. Ich kann Sie auch gerne noch mal telefonisch kontaktieren und wir können das weitere Vorgehen durchsprechen.
Ich bin so happy, das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll! Dabei habe ich mich erst vor einer Kontaktaufnahme mit Ihnen gescheut, weil ich dachte, der Mann hat anderes zu tun, als sich Deine Probleme anzuhören! Aber ich bin so froh, dass ich mich durchgerungen habe und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr belästigt.
Wäre ich zu einem unserer Ernährungsberater vor Ort gegangen, hätten die mir doch wieder nur eine LowFat-Diät auf Kohlenhydrath-Basis vorgeschlagen und DIESE Art von Diät habe ich wirklich schon oft genug (ZU OFT) gemacht und es hat nichts, aber auch gar nichts, gebracht!
Viele Liebe Grüße,
Birgit S.
Literatur:
1. Rasmussen BB, Holmback UC, Volpi E, Morio-Liondore B, Paddon-Jones D, Wolfe RR. Malonyl coenzyme A and the regulation of functional carnitine pal-mitoyltransferase-1 activity and fat oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1687-1693.
2. Jensen MD. Fatty acid oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1607-9.
3. Layman DK. Role of leucine in protein metabolism during exercise and recovery. Can J Appl Physiol 2002;27:646-63.
4. Remer T, Dimitriou T, Kersting M. Does fat intake explain fatness in healthy children? [letter]. 2002;56:1046–1047.
5. Liu S, Willett WC. Dietary glycemic load and atherothrombotic risk. Curr Athe-roscler Rep 2002;4:454-61.
6. Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum li-pids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55.
7. Dreon DM, Fernstrom HA, Miller B, Krauss RM. Low-density lipoprotein subc-lass patterns and lipoprotein response to a reduced-fat diet in men. Faseb J 1994;8:121-6.
8. Dreon DM, Fernstrom HA, Campos H, Blanche P, Williams PT, Krauss RM. Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men. Am J Clin Nutr 1998;67:828-36.
9. Bucher HC, Griffith LE, Guyatt GH. Systematic review on the risk and benefit of different cholesterol- lowering interventions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999;19:187-95.
10. Hooper L, Summerbell CD, Higgins JP, et al. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. Bmj 2001;322:757-63.
Echter geht es nicht - und so werden wir uns in der Tat am 25.10. sehen und vielleicht auch diskutieren.
Ich bin beruflich viel verreist und komme deshalb leider erst heute zu einer Replik zu Ihrem Kommentar vom 29. Juli.
Zu Ihrem Hinweis, Sie hätten in Bezug auf „Atkins“ im Forum alles wesentliche schon mehrfach erläutert, erlaube ich mir zunächst ganz allgemein anzumerken, dass unzutreffende Äußerungen nicht dadurch richtiger werden, dass man sie häufig wiederholt.
Ganz konkret lassen Ihre Äußerungen eher darauf schließen, dass Sie bislang das Prinzip und die Wirkungsweise kohlenhydratreduzierter Kostformen noch nicht erkennen.
Bei Atkins & Co geht es nicht primär und eine Erhöhung der Fettzufuhr! Das ist ein sekundärer Begleiteffekt. Vielmehr geht es erstens um die Senkung der Kohlenhydrate (KH) – vor allem der mit hohem Glykämischem Index – und zweitens um eine deutliche Anhebung der Zufuhr von Eiweiß.
zu 1.: Die KH-Reduzierung bewirkt eine Stabilisierung der Blutzucker und Insulinspiegel auf niedrigem Niveau, minimiert das Risiko reaktiver Hypoglykämien und dadurch ausgelöste Hunger- und Appetitattacken. Andererseits maximiert eine KH-Einschränkung die Fettoxidation: Jedes KH-reiche Mahl bedingt eine postprandiale Hyperglykämie und Hyperinsulinämie, wodurch in direkter Folge die Fettverbrennung massiv gehemmt wird (1, 2). Eine Störung des Fettstoffwechsels ist die Folge (siehe unten).
zu 2.: Die Eiweißerhöhung fördert die Glukoneogenese vor allem über Nacht, stablisiert also den Blutzuckerspiegel und minimiert die Wahrscheinlichkeit für Hungerattacken – insbesondere für morgendliche (3). Weiterhin garantiert eine hohe Eiweißzufuhr einen starken Sättigungseffekt.
Aber was auch immer noch an physiologischen Zusammenhängen dahinter stehen und welche Theorien man auch sonst noch dazu formulieren mag, entscheidend ist die tatsächliche Wirkung. Die haben Hunderttausende Übergewichtige am eigenen Leib erlebt und nun ist sie auch in entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten dokumentiert: Eine KH-reduzierte Kost à la Atkins & Co führt SPONTAN zu einer Senkung der Energieaufnahme. Die von mir zitierten Studien mit Atkins-Diät sind ja alle „ad libitum“ durchgeführt worden! Die Probanden erhielten keinerlei Kalorienbeschränkung. Sie durften sich immer satt essen. Die Gewichtsabnahme unter Atkins & Co ist also erwiesenermaßen nicht nur effizienter als mit fettreduzierter, KH-reicher Ernährung, sie gelingt noch dazu ohne die üblichen Hungerqualen. Und daneben bewirkt diese KH-reduzierte Diät auch noch ein besseres Risikofaktorprofil, als die fettreduzierte, KH-reiche Kost. Mit weniger radikalen Ernährungsumstellungen, z. B. mit der von mir propagierten LOGI-Methode ist man gleichzeitig auch auf Dauer ohne Risiko für eine Mangelversorgung im Nährstoffbereich und hat keine Säurenbelastung zu befürchten.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht Ihrem und dem Weltbild vieler anderer „Ernährungsexperten“ entspricht, wenn eine Kost, die bis zu 60 % Fett und noch dazu ü-berwiegend tierisches enthält, zu einer deutlich REDUZIERTEN Energieaufnahme beiträgt und damit das Therapieziel „Abnehmen und Normalisierung des entgleisten Stoffwechsels“ besser erreicht wird, als mit der herkömmlich propagierten fettarmen Diät. Aber diese Fakten sind nicht mehr nach dem Motto „was nicht sein darf, kann nicht sein“ weg zu diskutieren. Wer es nicht glaubt, soll einen heroischen Selbstversuch durchführen – das fördert die Akzeptanz ungemein. Jeder kann schnell feststellen, dass die hohe Eiweißzufuhr in Kombination mit der hohen Zufuhr an stärkearmem aber ballaststoffreichem Gemüse und Salat eine ausgeprägte und lang anhaltende Sättigung bewirkt, so dass insgesamt die Energiezufuhr spontan sinkt und man abnimmt. Kohlenhydratreiche Kostformen dagegen, vor allem bei hohem Glykämischem Index, führen dagegen offenbar dazu, dass relativ mehr Hunger- und Appetitsignale entstehen, als an Energie tatsächlich benötigt wird: Sie stören offenbar den physiologisch „gesunden“ Signalstoffwechsel...
Vor den dokumentierten Wirkungen sind entsprechend auch all Ihre theoretischen Ausführungen hinsichtlich der vermeintlichen Risiken durch fettreiche Kostformen („hohe Energiedichte“, „positive Energiebilanz“, „freie Fettsäuren“, „Förderung der In-sulinresistenz“ etc.) - so plausibel sie auch nach herkömmlicher Lehrmeinung anmuten mögen – Makulatur, um nicht zu sagen geradezu grotesk. Die neuen Studien haben ja ausgewiesen, dass mit solch eiweißreichen, KH-reduzierten Diäten insbesondere das viszerale Fett abgebaut wird. Wer abnimmt und noch dazu in hohem Masse das intraabdominale Fett, erfährt eine deutliche Minderung der Insulinresistenz. Sind die dokumentierten gesenkten Nüchtern-Insulinspiegel etwa ein Zeichen von gesteigerten Insulinresistenz? Unzählige Typ 2 Diabetiker haben erlebt, dass unter KH-reduzierten Kostformen die Medikation bzw. die Insulindosis zum Teil dramatisch gesenkt werden muss, um nicht in den Unterzucker zu kommen. Auch dies dürfte ja kaum ein Zeichen von verstärkter Insulinresistenz sein!
Ich teile Ihre Meinung, dass viele Menschen einfach zu viel essen – das heißt mehr als sie brauchen und folglich wegen der positiven Energiebilanz dick und insulinresistent werden. Könnten Sie dann aber bitte einmal erklären, warum Sie mit Vehemenz Menschen davon abbringen wollen, sich auf eine Kostform umzustellen, die ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit eher dazu verhilft, eine ausgewogene Energiebilanz bzw. im Fall von Übergewicht eine negative Energiebilanz zu erreichen, als mit allen anderen Kostformen? Noch dazu wenn dies gleichzeitig auch noch relevante Risikofaktoren günstiger beeinflusst, als mit den herkömmlichen Ernährungsumstellungen. Wie können Sie das eigentlich mit Ihrem ärztlichen Eid („...Schaden vom Patienten abhalten...“) vereinbaren?
Ich hänge unten beispielhaft einen Erfahrungsbericht einer Betroffenen an, der ich empfohlen hatte, zunächst mit Atkins-Diät anzufangen und dann auf die LOGI-Methode umzusteigen. Wer mit der Dame persönlich Kontakt zwecks Erfahrungsaustausch aufnehmen will, soll mich direkt anmailen (nicolai.worm@t-online.de).
Lassen Sie mich auch noch ein paar allgemeine Anmerkungen zu Ihren Thesen machen:
1. Ich kenne keine einzige repräsentative Studie, die einen Fettanteil von 50% der E-nergie in unserer Bevölkerung dokumentierte. Diese von Ihnen immer wieder genannte Zahl ist reine Phantasie. Vielmehr wird in entspechenden wissenschaftichen Bevölkerungsstudien ein Fettkonsum – wie von „calvin“ im Forum bereits korrekt vermerkt – von knapp unter 40% ausgewiesen und er sinkt seit Jahren minimal aber kontinuierlich. Dabei werden die Menschen immer fetter. Das weniger an Fett kompensieren sie durch mehr Kohlenhydrate. Das ist gerade auch wieder an einer Kohorte deutscher Kinder belegt worden (4).
2. Eine kohlenhydratreiche Nahrung bedingt eine postprandiale Hyperglykämie und Hyperinsulinämie, was als direkte Folge die Fettverbrennung massiv hemmt (1, 2). Eine Störung des Fettstoffwechsels ist die Konsequenz. Umgekehrt fördert eine kohlenhydratreduziete Kost die Fettoxidation und eine Verbesserung der Fettstoffwechselwerte [Übersicht in (5)].
Die von Prof. Elmadfa und anderen etablierten Fachleuten empfohlene Senkung der Fettzufuhr von gegenwärtig knapp 40% auf etwa 30 % und entsprechende Anhebung der Kohlenhydrate auf 55% würde zwar zu einer Senkung des LDL-Cholesterins führen, gleichzeitig aber auch zu einer überproportionalen Senkung des HDL-Cholesterins. Damit erreicht man eine Erhöhung des Verhältnisses von Gesamt- bzw. LDL-zu HDL-Cholesterin. Darüber hinaus kommt es zu einem Anstieg des VLDL-Cholesterins und der Triglyceride! Diese Effekte der fettreduzierten, kohlenhydratbetonten Kost sind in Dutzenden von Einzelarbeiten in den letzten Jahrzehnten beschrieben worden. Ich weise ja nicht zufällig in meinen Bücher und Vorträgen seit 15 Jahren schon darauf hin.
Diese unerwünschten Nebenwirkungen sind nun aber im Mai 2003 auch mittels einer Metaanalyse, in der die 60 methodisch besten Stoffwechselstudien der letzten Jahrzehnte eingingen, eindrücklich bestätigt worden (6). Dass diese Ernährungsweise zudem auch noch die Konzentration der besonders atherogenen kleinen dichten LDL-Partikeln erhöht, ist auch schon seit vielen Jahren bekannt (7, 8). Hätten Medikamente solche Reaktionen würde man sie wahrscheinlich wegen Erhöhung des Herzinfarktrisikos verbieten. Hinzu kommt, dass es für diese „fettbewußte Diät“ im Gegensatz zur medikamentösen Therapie mit Statinen keine Evidenz eines präventiven Effekts hinsichtlich klinisch relevanter, „harter“ Endpunkte gibt (9, 10).
Fazit: Die positive Energiebilanz ist die Ursache für Übergewicht. Wenn die meisten Menschen unter einer eiweiß- fett- und ballaststoffreichen, kohlenhydratreduzierten Kost offenbar ihre Energiezufuhr effektiver kontrollieren bzw. bei Übergewicht ohne Hungerqualen dauerhafter senken können, als unter einer kohlenhydratbetonten Kost, dann sollte sie für diese Menschen das Mittel der Wahl sein.
Mit besten Wünschen,
Nicolai
____________________
25.07.2003
Hallo,
hier die versprochene E-Mail wg. der Adresse.
Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie am Telefon eben so "zugelabert" habe, aber Sie können meine Begeisterung sicher nachvollziehen...
Ich sehe DEN Tag als einen meiner glücklichsten an, an dem ich mich entschlossen habe, Sie zu kontaktieren. Vielen Dank noch mal, dass Sie sich die Mühe gemacht haben.
Viele liebe Grüße
Birgit S.
02.07.2003
Guten Morgen Herr Worm,
ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, aber wir haben Anfang April 2003 miteinander telefoniert. Damals habe ich Ihnen mein Leid geklagt wg. meiner schlechten Blutwerte und meines doch recht starken Übergewichts, das ich wg. Rückenprobleme doch etwas reduzieren sollte.
Sie rieten mir seiner Zeit zur Atkins-Diät, a) wg. der Ernährungsumstellung und b) wg. der relativ schnellen Gewichtsabnahme und baten um Rückmeldung, wie es anschlägt und ob ich damit zurecht komme.
Hier nun die versprochene Rückmeldung:
Ende April habe ich mit Low-Carb begonnen, seit dem 7. Mai 2003 mache ich streng die "Atkins-Diät". Bis heute habe ich gute 10 Kilo abgenommen und das Beste: Meine Blutwerte sind wieder im grünen Bereich.
Hier habe ich sie mal aufgelistet:
(Die erste Spalte beschreibt die Werte vom 30. Juni 2003, die zweite die Werte vom 3. März 2003 (die Werte mit dem "+" waren die erhöhten))
30.06.03 03.03.03
Blutsenkung 11/23 6/15
Cholesterin gesamt 168 191
Triglyceride 115 645 +
HDL-Cholesterin 42 46
LDL-Cholesterin 103 Serum lipös
CHOL/HDL 4,0 4,2
C-reakt. Protein <5.0 6,0 +
HbA1-c 4,4
ST3G 0,77 1,82 +
T4 6,6 12,1 +
TSH basal 1,43 1,44
Bei der ersten Blutabnahme wurden noch die Schilddrüsenwerte und Leukozyten und Haemoglobin etc. ausgewertet, aber das war alles nicht auffällig und so wurde dieses mal darauf verzichtet.
Ist das nicht phantastisch???
Beim HDL-Wert steht hinter der 42 ein Minus in meiner Liste, das würde theoretisch heißen, dass der Wert zu niedrig ist, ich habe allerdings im Internet einen anderen Wert gefunden und nach diesem wäre mein Wert im Okay-Bereich. Was stimmt denn nun?
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich noch mal bei mir melden würden. Ich kann Sie auch gerne noch mal telefonisch kontaktieren und wir können das weitere Vorgehen durchsprechen.
Ich bin so happy, das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll! Dabei habe ich mich erst vor einer Kontaktaufnahme mit Ihnen gescheut, weil ich dachte, der Mann hat anderes zu tun, als sich Deine Probleme anzuhören! Aber ich bin so froh, dass ich mich durchgerungen habe und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr belästigt.
Wäre ich zu einem unserer Ernährungsberater vor Ort gegangen, hätten die mir doch wieder nur eine LowFat-Diät auf Kohlenhydrath-Basis vorgeschlagen und DIESE Art von Diät habe ich wirklich schon oft genug (ZU OFT) gemacht und es hat nichts, aber auch gar nichts, gebracht!
Viele Liebe Grüße,
Birgit S.
Literatur:
1. Rasmussen BB, Holmback UC, Volpi E, Morio-Liondore B, Paddon-Jones D, Wolfe RR. Malonyl coenzyme A and the regulation of functional carnitine pal-mitoyltransferase-1 activity and fat oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1687-1693.
2. Jensen MD. Fatty acid oxidation in human skeletal muscle. J Clin Invest 2002;110:1607-9.
3. Layman DK. Role of leucine in protein metabolism during exercise and recovery. Can J Appl Physiol 2002;27:646-63.
4. Remer T, Dimitriou T, Kersting M. Does fat intake explain fatness in healthy children? [letter]. 2002;56:1046–1047.
5. Liu S, Willett WC. Dietary glycemic load and atherothrombotic risk. Curr Athe-roscler Rep 2002;4:454-61.
6. Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum li-pids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55.
7. Dreon DM, Fernstrom HA, Miller B, Krauss RM. Low-density lipoprotein subc-lass patterns and lipoprotein response to a reduced-fat diet in men. Faseb J 1994;8:121-6.
8. Dreon DM, Fernstrom HA, Campos H, Blanche P, Williams PT, Krauss RM. Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men. Am J Clin Nutr 1998;67:828-36.
9. Bucher HC, Griffith LE, Guyatt GH. Systematic review on the risk and benefit of different cholesterol- lowering interventions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999;19:187-95.
10. Hooper L, Summerbell CD, Higgins JP, et al. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. Bmj 2001;322:757-63.