App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
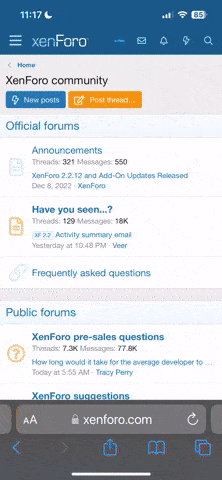
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Karpaltunnelsyndrom
- Ersteller ooops
- Erstellt am
A
Anzeige
schau mal hier:
osteophytenabtragung .
Hatten wir hier
lieber ooops,
erst vor kurzem. Vielleicht hilft Dir das:
Karpaltunnelsyndrom
Synonyme:
Brachialgia paraesthetica nocturna (Symptom), Carpaltunnelsyndrom, CTS, KTS
Schlüsselwörter:
N. medianus, Karpaltunnel, Karpaltunnelsyndrom, Endoskopie, carpal tunnel syndrome
Definition
Bei einem Karpaltunnelsyndrom (KTS) handelt es sich um eine meist chronische Kompressionsneuropathie des N. medianus im Bereich des Handgelenkes.
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie
Häufigstes Kompressionssyndrom peripherer Nerven. Der Nerv befindet sich mit weiteren anatomischen Strukturen in einem osteofibrösen Kanal. Durch die Diskrepanz zwischen Tunnelvolumen und dessen Inhalt kommt es zur Nervenkompression. Das Ausmaß der Nervenschädigung hängt vor allem von Stärke und Dauer der Kompression ab. Eine Polyneuropathie kann Verlauf und Therapie ungünstig beeinflussen.
Mögliche Ursachen:
Idiopathisch (häufigste Form)
Sekundär:
In Fehlstellung verheilte distale Radiusfraktur
Sub- oder Luxation eines Handwurzelknochens (z.B. perilunäre Luxation)
Osteophytenbildung bei Handgelenksarthrose
Rheumatische Erkrankungen der Gelenke und Sehnenscheiden
Posttraumatisch (akut traumatisch: Hämatom, Thrombose, Ödem. Vernarbungen, Infektion, Knochensplitter)
Tumoren (z.B. Handgelenksganglion, Neurinome)
Abnorme Muskelverläufe
Endokrine und hormonelle Veränderungen: Gravidität, Diabetes mellitus, Akromegalie, Hypothyreose
Stoffwechselerkrankungen (Gicht, Amyloidose, Mukolipidose, Mukopolysaccharidose)
Klassifikation
Derzeit keine validierte Stadieneinteilung bekannt.
Medizinische Schlüsselsysteme
ICD-10
G56.0 Karpaltunnel-Syndrom
Anamnese
Spezielle Anamnese
Nächtliche Parästhesie und Schmerzen im Versorgungsgebiet des N. medianus (D I-III und D IV radial)
Parästhesien und Schmerzen bei Haltearbeit der Hand
Hypästhesie im Ausbreitungsgebiet des N. medianus
Ungeschicklichkeit und Schwäche der Hand
Schmerzausstrahlung in den Unterarm/Oberarm
Schwierigkeiten bei Fein- und Spitzgriff (z.B. Nähen, Auf- und Zuknöpfen, Aufheben von kleinen Gegenständen)
Atrophie der Daumenballenmuskulatur
Beeinträchtigung der Sensorik
Allgemeine Anamnese
Trauma, Überbeanspruchung der Hand, rheumatische Beschwerden oder Symptome (Morgensteifigkeit der Finger), Diabetes mellitus, Polyneuropathie, Schwangerschaft, Menopause
Familienanamnese
Sozialanamnese: Beruf
Diagnostik
Klinische Diagnostik
Inspektion
Beurteilung von
Daumenballenmuskulatur (Atrophie)
Haut (trophische Störungen, trockene, samtartige Haut)
Atrophie der Fingerkuppen
Handgelenk und benachbarten Gelenken (Schwellung)
Palpation
Beurteilung von
Schwellung und Druckschmerz im Bereich des Karpaltunnels
Sehnenscheiden
Spezifische Funktions- und Schmerztests
Positives Hoffmann-Tinel-Zeichen: beim Beklopfen des N. medianus in Höhe des Handgelenkes Auslösen von Parästhesien
Opposition und Abduktion des Daumens
Palmarflexionstest (Phalen-Test)
Dorsalextensionstest (Brain-Test)
Zweipunkte-Diskriminierung
Tourniquet-Test (Gilliati und Wilson)
Messung: Zweipunkte-Diskriminierung nach Weber
Apparative Diagnostik
Notwendige apparative Untersuchungen
Röntgen Hand a.p. und Röntgen Handgelenk seitlich
Elektrophysiologische Untersuchung
Elektroneurographie (ENG)
Elektromyographie (EMG)
Im Einzelfall nützliche apparative Untersuchungen
Weitere Röntgenaufnahmen (Karpaltunnelaufnahme, HWS)
Ultraschall
CT, MRT
Labor zur Differentialdiagnose (z.B. Diabetes mellitus, rheumatische Erkrankung, Gicht)
Häufige Differentialdiagnosen
Medianus-Kompressions-Syndrom in Höhe des Unterarmes (Pronator-teres-Syndrom)
Irritation des Plexus brachialis
Zerviko-Brachial-Syndrom
N. ulnaris-Kompressionssyndrome
Pseudoradikuläres Syndrom
Thoracic-Outlet-Syndrom
Polyarthrose, rheumatische Gelenkerkrankungen
Klinische Scores
Kein valider Score in der Literatur bekannt für die Bewertung eines Karpaltunnelsyndroms.
Therapie
Ziele
Beseitigung der Kompression des Nerven und der Folgen (Schmerzen, Parästhesie, sensible und motorische Störungen).
Konservative Therapie
Beratung
Aufklärung über die Erkrankung, deren natürlichen Verlauf und dessen Beeinflussbarkeit durch konservative und operative Therapie. Die Beratung ist individuell zu gestalten und umfasst u.a. eine Aufklärung über Möglichkeiten der Reduktion und Vermeidung von Überanstrengung und Fehlbelastung im Alltagsleben, Beruf und Sport.
Medikamentöse Therapie
Nichtsteroidale Antirheumatika, Analgetika
Injektion von Steroiden in den Karpalkanal zur Abschwellung des Synovialisgewebes (Cave: Sehnenruptur)
Physikalische Therapie
Physiotherapie
Orthopädietechnik
Ruhigstellung des Handgelenkes auf einer Unterarmschiene in Funktionsstellung.
Operative Therapie
Allgemeine Indikationskriterien
Leidensdruck
Therapieresistenz
Schmerz
Neurologische Ausfälle
Bei Versagen der konservativen Behandlung Abwägen der Beeinträchtigung durch Schmerzen und/oder neurologische Ausfälle.
Beim sekundären KTS (z.B. rheumatoide Arthritis, posttraumatisch) ist die Beseitigung der Ursachen die Methode der Wahl.
Bei vorliegender Schwangerschaft empfiehlt sich in Abhängigkeit von Beschwerden und restlicher Schwangerschaftsdauer eine abwartende Haltung.
Kontraindikation
Keine ausreichende konservative Behandlung
Operationsprinzip
Spaltung und Offenlassen des Retinaculum flexorum. Prinzipiell kommen offene oder endoskopische Verfahren zur Anwendung. Beseitigung der primären Ursachen.
Häufige Operationsverfahren
Prinzipiell kommen folgende Verfahren in Frage:
Offene Dekompression
mit oder ohne Neurolyse bzw. Epineurotomie
mit oder ohne Tenosynovialektomie
mit flankierenden Maßnahmen: Osteophytenabtragung, Ganglionentfernung, Bandplastik
Endoskopische Retinakulumspaltung
Mögliche Folgen und Komplikationen
Allgemeine Risiken und Komplikationen:
Hämatom, Wundheilungsstörung, Wundinfekt, Embolie, Gefäßverletzung, Nervenverletzung (motorischer Ast des N. medianus, N. ulnaris, R. palmaris des N. medianus)
Spezielle Folgen:
Bewegungseinschränkung, druckschmerzhafte Narbe
Spezielle Komplikationen:
Im fortgeschrittenen Stadium kann die Wiedererlangung der Sensibilität und insbesondere der Motorik ausbleiben. Neurombeschwerden. Gefühlsstörungen bei Durchtrennung des R. palmaris. Kraftverlust. "Bow stringing" der Flexorensehnen. Rezidiv nach inkompletter Spaltung des Karpaltunnels
Postoperative Maßnahmen
Verband meist ausreichend
Ggf. spezielle Lagerungsschiene
Individuelle postoperative Physiotherapie
Aufklärung über erlaubte Bewegungen und Belastbarkeit. Frühfunktionelle Übungen für die Finger. Aufklärung über regelmäßige postoperative Kontrollen
Stufenschema Therapeutisches Vorgehen
Orientierungskriterien
Ätiologie, Schmerz, Leidensdruck, berufliche Situation, Sensibilitätsstörung, motorische Ausfälle
Stufe 1 ambulant
Beratung, medikamentöse Therapie, Schienenruhigstellung, Infiltration
Stufe 2 ambulant/stationär
Operative Retinakulumspaltung, ggf. Erweiterung des Eingriffs (s.o.)
Prognose
In der Regel gut. Prognose umso besser, je geringer neurologisches Defizit. Schmerz und Parästhesien sind postoperativ meist rasch rückläufig. Der Sensibilitätsverlust bessert sich langsam. Die Muskelatrophie hat eine schlechtere Prognose. Rezidive sind selten.
Prävention
Bei sekundären Formen ist ggf. Prävention möglich.
Gruß Rainer
lieber ooops,
erst vor kurzem. Vielleicht hilft Dir das:
Karpaltunnelsyndrom
Synonyme:
Brachialgia paraesthetica nocturna (Symptom), Carpaltunnelsyndrom, CTS, KTS
Schlüsselwörter:
N. medianus, Karpaltunnel, Karpaltunnelsyndrom, Endoskopie, carpal tunnel syndrome
Definition
Bei einem Karpaltunnelsyndrom (KTS) handelt es sich um eine meist chronische Kompressionsneuropathie des N. medianus im Bereich des Handgelenkes.
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie
Häufigstes Kompressionssyndrom peripherer Nerven. Der Nerv befindet sich mit weiteren anatomischen Strukturen in einem osteofibrösen Kanal. Durch die Diskrepanz zwischen Tunnelvolumen und dessen Inhalt kommt es zur Nervenkompression. Das Ausmaß der Nervenschädigung hängt vor allem von Stärke und Dauer der Kompression ab. Eine Polyneuropathie kann Verlauf und Therapie ungünstig beeinflussen.
Mögliche Ursachen:
Idiopathisch (häufigste Form)
Sekundär:
In Fehlstellung verheilte distale Radiusfraktur
Sub- oder Luxation eines Handwurzelknochens (z.B. perilunäre Luxation)
Osteophytenbildung bei Handgelenksarthrose
Rheumatische Erkrankungen der Gelenke und Sehnenscheiden
Posttraumatisch (akut traumatisch: Hämatom, Thrombose, Ödem. Vernarbungen, Infektion, Knochensplitter)
Tumoren (z.B. Handgelenksganglion, Neurinome)
Abnorme Muskelverläufe
Endokrine und hormonelle Veränderungen: Gravidität, Diabetes mellitus, Akromegalie, Hypothyreose
Stoffwechselerkrankungen (Gicht, Amyloidose, Mukolipidose, Mukopolysaccharidose)
Klassifikation
Derzeit keine validierte Stadieneinteilung bekannt.
Medizinische Schlüsselsysteme
ICD-10
G56.0 Karpaltunnel-Syndrom
Anamnese
Spezielle Anamnese
Nächtliche Parästhesie und Schmerzen im Versorgungsgebiet des N. medianus (D I-III und D IV radial)
Parästhesien und Schmerzen bei Haltearbeit der Hand
Hypästhesie im Ausbreitungsgebiet des N. medianus
Ungeschicklichkeit und Schwäche der Hand
Schmerzausstrahlung in den Unterarm/Oberarm
Schwierigkeiten bei Fein- und Spitzgriff (z.B. Nähen, Auf- und Zuknöpfen, Aufheben von kleinen Gegenständen)
Atrophie der Daumenballenmuskulatur
Beeinträchtigung der Sensorik
Allgemeine Anamnese
Trauma, Überbeanspruchung der Hand, rheumatische Beschwerden oder Symptome (Morgensteifigkeit der Finger), Diabetes mellitus, Polyneuropathie, Schwangerschaft, Menopause
Familienanamnese
Sozialanamnese: Beruf
Diagnostik
Klinische Diagnostik
Inspektion
Beurteilung von
Daumenballenmuskulatur (Atrophie)
Haut (trophische Störungen, trockene, samtartige Haut)
Atrophie der Fingerkuppen
Handgelenk und benachbarten Gelenken (Schwellung)
Palpation
Beurteilung von
Schwellung und Druckschmerz im Bereich des Karpaltunnels
Sehnenscheiden
Spezifische Funktions- und Schmerztests
Positives Hoffmann-Tinel-Zeichen: beim Beklopfen des N. medianus in Höhe des Handgelenkes Auslösen von Parästhesien
Opposition und Abduktion des Daumens
Palmarflexionstest (Phalen-Test)
Dorsalextensionstest (Brain-Test)
Zweipunkte-Diskriminierung
Tourniquet-Test (Gilliati und Wilson)
Messung: Zweipunkte-Diskriminierung nach Weber
Apparative Diagnostik
Notwendige apparative Untersuchungen
Röntgen Hand a.p. und Röntgen Handgelenk seitlich
Elektrophysiologische Untersuchung
Elektroneurographie (ENG)
Elektromyographie (EMG)
Im Einzelfall nützliche apparative Untersuchungen
Weitere Röntgenaufnahmen (Karpaltunnelaufnahme, HWS)
Ultraschall
CT, MRT
Labor zur Differentialdiagnose (z.B. Diabetes mellitus, rheumatische Erkrankung, Gicht)
Häufige Differentialdiagnosen
Medianus-Kompressions-Syndrom in Höhe des Unterarmes (Pronator-teres-Syndrom)
Irritation des Plexus brachialis
Zerviko-Brachial-Syndrom
N. ulnaris-Kompressionssyndrome
Pseudoradikuläres Syndrom
Thoracic-Outlet-Syndrom
Polyarthrose, rheumatische Gelenkerkrankungen
Klinische Scores
Kein valider Score in der Literatur bekannt für die Bewertung eines Karpaltunnelsyndroms.
Therapie
Ziele
Beseitigung der Kompression des Nerven und der Folgen (Schmerzen, Parästhesie, sensible und motorische Störungen).
Konservative Therapie
Beratung
Aufklärung über die Erkrankung, deren natürlichen Verlauf und dessen Beeinflussbarkeit durch konservative und operative Therapie. Die Beratung ist individuell zu gestalten und umfasst u.a. eine Aufklärung über Möglichkeiten der Reduktion und Vermeidung von Überanstrengung und Fehlbelastung im Alltagsleben, Beruf und Sport.
Medikamentöse Therapie
Nichtsteroidale Antirheumatika, Analgetika
Injektion von Steroiden in den Karpalkanal zur Abschwellung des Synovialisgewebes (Cave: Sehnenruptur)
Physikalische Therapie
Physiotherapie
Orthopädietechnik
Ruhigstellung des Handgelenkes auf einer Unterarmschiene in Funktionsstellung.
Operative Therapie
Allgemeine Indikationskriterien
Leidensdruck
Therapieresistenz
Schmerz
Neurologische Ausfälle
Bei Versagen der konservativen Behandlung Abwägen der Beeinträchtigung durch Schmerzen und/oder neurologische Ausfälle.
Beim sekundären KTS (z.B. rheumatoide Arthritis, posttraumatisch) ist die Beseitigung der Ursachen die Methode der Wahl.
Bei vorliegender Schwangerschaft empfiehlt sich in Abhängigkeit von Beschwerden und restlicher Schwangerschaftsdauer eine abwartende Haltung.
Kontraindikation
Keine ausreichende konservative Behandlung
Operationsprinzip
Spaltung und Offenlassen des Retinaculum flexorum. Prinzipiell kommen offene oder endoskopische Verfahren zur Anwendung. Beseitigung der primären Ursachen.
Häufige Operationsverfahren
Prinzipiell kommen folgende Verfahren in Frage:
Offene Dekompression
mit oder ohne Neurolyse bzw. Epineurotomie
mit oder ohne Tenosynovialektomie
mit flankierenden Maßnahmen: Osteophytenabtragung, Ganglionentfernung, Bandplastik
Endoskopische Retinakulumspaltung
Mögliche Folgen und Komplikationen
Allgemeine Risiken und Komplikationen:
Hämatom, Wundheilungsstörung, Wundinfekt, Embolie, Gefäßverletzung, Nervenverletzung (motorischer Ast des N. medianus, N. ulnaris, R. palmaris des N. medianus)
Spezielle Folgen:
Bewegungseinschränkung, druckschmerzhafte Narbe
Spezielle Komplikationen:
Im fortgeschrittenen Stadium kann die Wiedererlangung der Sensibilität und insbesondere der Motorik ausbleiben. Neurombeschwerden. Gefühlsstörungen bei Durchtrennung des R. palmaris. Kraftverlust. "Bow stringing" der Flexorensehnen. Rezidiv nach inkompletter Spaltung des Karpaltunnels
Postoperative Maßnahmen
Verband meist ausreichend
Ggf. spezielle Lagerungsschiene
Individuelle postoperative Physiotherapie
Aufklärung über erlaubte Bewegungen und Belastbarkeit. Frühfunktionelle Übungen für die Finger. Aufklärung über regelmäßige postoperative Kontrollen
Stufenschema Therapeutisches Vorgehen
Orientierungskriterien
Ätiologie, Schmerz, Leidensdruck, berufliche Situation, Sensibilitätsstörung, motorische Ausfälle
Stufe 1 ambulant
Beratung, medikamentöse Therapie, Schienenruhigstellung, Infiltration
Stufe 2 ambulant/stationär
Operative Retinakulumspaltung, ggf. Erweiterung des Eingriffs (s.o.)
Prognose
In der Regel gut. Prognose umso besser, je geringer neurologisches Defizit. Schmerz und Parästhesien sind postoperativ meist rasch rückläufig. Der Sensibilitätsverlust bessert sich langsam. Die Muskelatrophie hat eine schlechtere Prognose. Rezidive sind selten.
Prävention
Bei sekundären Formen ist ggf. Prävention möglich.
Gruß Rainer
kurt1
New member
siehe "Karpaltunnelsyndrom" im Archiv
hier die einträge dazu: http://www.fitness.com/phpapps/ubbthreads/dosearch.php?Cat=2&Forum=All_Forums&Words=karpaltunnelsyndrom&Match=And&Old=allposts&Limit=2500
weiterer suchbegriff: "CTS"
gruß, kurt
hier die einträge dazu: http://www.fitness.com/phpapps/ubbthreads/dosearch.php?Cat=2&Forum=All_Forums&Words=karpaltunnelsyndrom&Match=And&Old=allposts&Limit=2500
weiterer suchbegriff: "CTS"
gruß, kurt
Re: Hatten wir hier
Hallo Rainer, hallo Kurt!
Vielen Dank für eure Antworten.
Heisst also, ich sollte bald was unternehmen, bevor ich gar nicht mehr zugreifen kann....? Bin nämlich eher der Typ der sagt: Kommt Zeit, kommt Besserung!
Und "Schnippeleien" stehe ich sowieso kritisch gegenüber, eben wegen des unsicheren Ausgangs!
Zudem ist Sport nicht nur mein Hobby sondern auch mein Beruf !!!
Und Gruß!
Hallo Rainer, hallo Kurt!
Vielen Dank für eure Antworten.
Heisst also, ich sollte bald was unternehmen, bevor ich gar nicht mehr zugreifen kann....? Bin nämlich eher der Typ der sagt: Kommt Zeit, kommt Besserung!
Und "Schnippeleien" stehe ich sowieso kritisch gegenüber, eben wegen des unsicheren Ausgangs!
Zudem ist Sport nicht nur mein Hobby sondern auch mein Beruf !!!
Und Gruß!