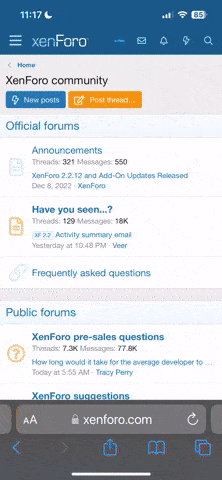Re: USA als Vorbild
Die „USA“ sind insofern kein Argument, als daß die USA einen Bundesstaat darstellt, deren komplexe rechtliche Strukturierung in erster Linie Juristen Einsicht bietet. Wer daher nur auf drei Buchstaben rekurriert, dünnt mutwillig die Sachlage im Angesicht der unterschiedlichen Kompetenzen der einzelnen Staaten aus. Nicht anders ist es auch in den anderen westlichen Staaten, allen voran Deutschland. Das Gebiet, das gegenwärtig „reformiert“ werden soll – der Gesundheitssektor als Ausprägung des Gesundheitsrechts -, bildet einen Unterfall des Sozialrechts. In diesem Zusammenhang kommt man mit einer medizinischen Sicht der Dinge nicht weiter.
Eine allgemeine nationale Krankenversicherung in den USA gibt es bis heute noch nicht. Ein umfassender Gesetzesentwurf wurde erstmals im Jahre 1993 von Präsident Clinton eingebracht, scheiterte aber im Kongreß. Damit verfügen heute noch schätzungsweise 37 Millionen Amerikaner über keinen und weitere bis zu 30 Millionen US-Bürger über keinen ausreichenden Versicherungsschutz.
Das wichtigste Gesetz ist der „Social Security Act“ aus dem Jahre 1935. Social security beinhaltet unter anderem eine Krankenversicherung für Personen über 65 Jahre (Medicare) und für besonders Bedürftige und Arme (Medicaid). In den meisten Fällen handelt es sich um Bundesleistungen. (vgl. Dr. Peter Hay, Emory University Atlanta)
Zu den strukturellen Unterschieden gehören auch die Versicherungsleistungen. Nicht alles, was in Deutschland über die Kasse abgerechnet wird, trägt in den USA auch die Versicherung.
Die Unterschiede sind fundamental. In Deutschland hat man hierzu eine paternalistische Sichtweise geprägt von dem Gedanken der Solidargemeinschaft, während in den USA die Eigenfinanzierung vorherrscht.
Man sollte also eher von Modellen sprechen, aber auch hier darf man nicht zu stark induktiv argumentieren. Sozialrecht kann man nämlich auch als Verteilungsaufgabe bezeichnen, Geld den einen zu geben, das man anderen genommen hat bzw. nimmt. Die Mediziner kommen gerade an diesem Punkt ins Spiel. :winke:
Übrigens sehen sich Raucher ohnehin als Prügelknabe und Opfer der Nation (Ähnliches gilt auch für „die“ Autofahrer). Die Argumente: Tabaksteuer, Raucherzonen. Modelle, Raucher stärker auf der Seite der Versicherungsleistungen negativ zu berücksichtigen, können unterschiedlich ausfallen. Allerdings darf das nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine solche Debatte ethisch betrachtet scheinheilig ist, da man genauso gut auch den Tabak verbieten könnte. Hiergegen existieren auch Bedenken grundgesetzlicher Natur.
Ähnliches gilt auch für die konstitutionsabhängige Versicherungsprämie: Man kommt hier auch in Bereiche, bei denen sich – gewiß nicht in großem Ausmaß, aber immerhin – auch die Frage nach dem „Wrongful life“ stellt. Gerade die jüngste Debatte um Contergan als Erinnerung an eine Tragödie zeigt, daß manche Menschen nicht so können, wie dürfen wollten.
Fazit: Ich wollte mich nicht in den Interessensgruppen der Republik aufreiben lassen.
LG,
René
PS: Rechtshistorisch ist die gegenwärtige Debatte um das Gesundheitssystem hochinteressant. Abstrakt besehen handelt es sich um einen Sonderfall des Schadensersatzes. Und dieser nimmt in hochentwickelten Versicherungsgesellschaften weniger die Gestalt von Schicksalsschlägen an, als mehr die Gestalt eines finanziell wägbaren Risikos in Form einer Schadensverlagerung auf die Versicherung. Ähnliches meinte schon H. Kohl mit dem Begriff der „Vollkaskomentalität“.
PSS: Eine Reform, die niemanden finanziell belastet, kann keine sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik dem Wähler verkaufen will, daß die finanziellen Mehrbelastungen seine persönliche Freiheit stärken werden. Beim Geld hört ja bekanntlich jedwede Freundschaft auf. Bei manchen beginnt sie auch erst an diesem Punkte. :winke: