App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
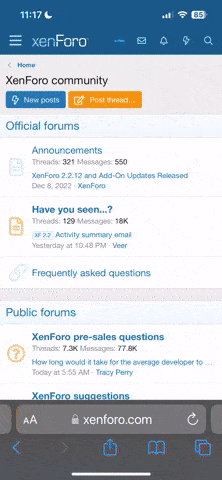
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Frodo hat versagt!
- Ersteller Honskeh
- Erstellt am
- Status
- Für weitere Antworten geschlossen.
A
Anzeige
schau mal hier:
meine wird immer .
Thunder567
New member
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiich seeeeeeeehhhhheeee dich 
Thunder
Thunder
imported_Duke
New member
verdammt, er war also schneller als ich 

Kommando
New member
Gut, dann gleich nochmal Sarumans Angriffsziel 
http://isch.bin.dem.krasseste.surfern.bei.t-online.de/dem.allern.krasseste/irak.jpg
http://isch.bin.dem.krasseste.surfern.bei.t-online.de/dem.allern.krasseste/irak.jpg
Honskeh
New member
Kennt ihr Michael Moore, den Filmemacher, der auch "bowling for Columbine" (siehe thread) gemacht hat?
mein vater hat letztens ein buch von dem gelesen, wo der kerl echt sehr stichhaltig BEWEIST (!), dass bei der US-Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush Verwandte von Bush die Zählungen so manipuliert haben, dass Bush knapp (er hat ja echt verdammt knapp gewonnen) gewinnen konnte!!!!!! der kerl hat ja die ganze familie in der us-politik.
Hart, oder?
Da war ich echt übel geschockt. Und ich möchte echt nicht wissen, was Die USA für Massenvernichtungswaffen besitzt.......
Und warum z.B. greifen sie Irak und nicht Nordkorea oder China an, die beide auch Massenvernichtungswaffen und gefährliche Regierungen besitzen...?!?!?!
Öl? Rache für 11.09.02?! Förderung der US-Waffeni9ndustrie?!?
---> So gut wie alle Konzerne der USA sind eng mit dem Pentagon verknüpft, die eigentlich relativ wenig mit Militär am hut haben sollten (Coca Cola, usw.)
Und dass sie sich über Entscheidung der UN (sollte sie denn gegen einen Irak-Krieg ausfallen), die ja dafür da ist Staaten in Sachen Menschenrechte grenzen zu setzen, hinwegsetzen würden, find ich wirklich zu viel.
Da muss was gegen getan werden, sag ich.
mein vater hat letztens ein buch von dem gelesen, wo der kerl echt sehr stichhaltig BEWEIST (!), dass bei der US-Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush Verwandte von Bush die Zählungen so manipuliert haben, dass Bush knapp (er hat ja echt verdammt knapp gewonnen) gewinnen konnte!!!!!! der kerl hat ja die ganze familie in der us-politik.
Hart, oder?
Da war ich echt übel geschockt. Und ich möchte echt nicht wissen, was Die USA für Massenvernichtungswaffen besitzt.......
Und warum z.B. greifen sie Irak und nicht Nordkorea oder China an, die beide auch Massenvernichtungswaffen und gefährliche Regierungen besitzen...?!?!?!
Öl? Rache für 11.09.02?! Förderung der US-Waffeni9ndustrie?!?
---> So gut wie alle Konzerne der USA sind eng mit dem Pentagon verknüpft, die eigentlich relativ wenig mit Militär am hut haben sollten (Coca Cola, usw.)
Und dass sie sich über Entscheidung der UN (sollte sie denn gegen einen Irak-Krieg ausfallen), die ja dafür da ist Staaten in Sachen Menschenrechte grenzen zu setzen, hinwegsetzen würden, find ich wirklich zu viel.
Da muss was gegen getan werden, sag ich.
Herminator
New member
@Honskeh
Typisch...keine Ahnung von garnix haben aber die Amis verteufeln.
Du solltest dich ein wenig im Internet umschauen verschiedene Meinungen einholen und mit einwenig Hintergrundwissen und Artikelrecherche nochmal posten oder still sein...
Typisch...keine Ahnung von garnix haben aber die Amis verteufeln.
Du solltest dich ein wenig im Internet umschauen verschiedene Meinungen einholen und mit einwenig Hintergrundwissen und Artikelrecherche nochmal posten oder still sein...
Herminator
New member
Ich stelle auch nicht irgednwelche Behauptungen auf.
n paar nette Artikel:
Die Mär vom Ölkrieg
Falsche Argumente gegen einen gefahrvollen Waffengang
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Eine immer junge These macht wieder Karriere: In Wahrheit sei das Öl der Treibstoff des drohenden Krieges. Eine Allianz aus Kapital und Kanonen, die „Achse des Öls“, mache sich auf, den Irak zur amerikanischen Tankstelle auszubauen, um den Sprit-Preis auf Dauer niedrig zu halten. Deshalb ruft von links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“ Von rechts geißelt Jürgen Todenhöfer die „rohstoffpolitische Kolonisierung“ des Irak. Auf dem Titelblatt des Spiegels wird eine Kreuzung aus Maschinengewehr und Zapfhahn zum Symbol Amerikas. Keine der Großdemonstrationen vom Wochenende kam ohne den Slogan „Blut für Öl“ aus.
Der Charme der Ölkrieg-Theorie besteht darin, dass er so einleuchtend wirkt. Denn niemand will sich mit der Behauptung lächerlich machen, Öl sei bei einem Krieg inmitten von Ölfeldern bedeutungslos. Ein jeder ahnt, dass die Konzerne (nicht nur die amerikanischen) bereits um die Bohrrechte im neuen Öldorado buhlen. Wer im meinungsbunten Washington lange genug sucht, wird schon jemanden finden, der zitierfähig behauptet, die Neuverteilung der Lizenzen sei nicht Folge, sondern Motiv des heraufziehenden Krieges. Schließlich regierten im Weißen Haus die Öl-Männer Bush und Cheney. Alles klar?
Vorbei: Schonzeit für die Saudis
Das Problem ist bloß, dass diese verschwörerische Lesart die große Wende der amerikanischen Politik nach dem 11. September ignoriert. Zuvor hatte ein ebenso stiller wie dubioser Pakt das Verhältnis zum wichtigsten Lieferanten am Golf regiert: Die Saudis pumpen Öl zu moderaten Preisen, und die Amerikaner stützen dafür die korrupte Prinzengarde. Dieser Deal ist mit den Türmen des World Trade Center zusammengebrochen. Stattdessen wächst die Einsicht, dass die traditionelle Nahost-Politik in der Sackgasse steckt. Politiker aller Couleur glauben jetzt, dass Terror gebiert, wer im Nahen Osten doppelzüngig Demokratie predigt und Autokratie fördert. So ist das gewaltige Missionsprojekt der Demokratisierung Arabiens entstanden. Ein herkulisches Unternehmen, das dem Glauben entspringt, nur gute Demokraten seien gute Partner. Diese Vision sehen Arabiens Alleinherrscher zu Recht als Bedrohung. Sie stellt einen radikalen Bruch dar: Idealpolitik ersetzt Realpolitik. Es ist, als wäre Woodrow Wilson wieder auferstanden, der die Welt nach 1918 „safe for democracy“ machen wollte.
Die Ent-Saddamisierung des Irak ist Teil dieses Projekts. Es wird aus der Angst geboren und nicht aus der Gier – aus der Asche der Wolkenkratzer, nicht aus Bauzeichnungen für Bohrtürme. Zum Gemeingut gehört in Washington die Befürchtung, beim nächsten Anschlag würde es nicht bei zwei Bürotürmen bleiben. Fast sicher wären dann Massenvernichtungswaffen im Spiel. Deshalb hat Amerika die Jagd auf Diktatoren mit solchen Waffen eröffnet. Deshalb wird der Abwehrkampf zu einer Präventionspolitik, der jedes Mittel recht zu sein scheint. Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht.
Diese Politik, die in ihrem Bekehrungsdrang bisweilen obsessiv wirkt, wirft viele quälende Fragen auf: Ist die Demokratisierung Arabiens von außen überhaupt möglich? Was sind die Grenzen eines Universalismus, der auf Panzerketten daherkommt? Ist Präventivkrieg auf Verdacht legitim? Es ist diese neue Außenpolitik, ihre Radikalität und ihr Hang zur Grenzverletzung, die nach Diskussion geradezu schreit. Doch Amerika zusätzlich sinistere Motive zu unterstellen, führt in die Irre. Die schrillsten Kritiker wollen Amerika zugleich Materialismus (Öl!) und Moralismus (Achse des Bösen!) vorwerfen. Beides geht aber schon logisch nicht zusammen.
Seit einigen Wochen verleiht die Nordkorea-Krise dem Öl-Argument scheinbar neuen Auftrieb. Da gibt es neben dem Irak ein weiteres Land – diktatorisch geführt, feindlich gesinnt –, das Massenvernichtungswaffen baut. Nordkorea soll aber nicht mit Krieg überzogen werden? Weil dort kein Öl sprudelt!, schallt es zurück.
Merkwürdig, wie Amerikas Konservative noch immer unterschätzt werden. Natürlich weiß auch George Bush, dass er mit unterschiedlicher Elle misst. Aber ihm ist klar, dass er zwei Kriege gleichzeitig nicht riskieren darf. Deshalb bietet er Gespräche mit den Nordkoreanern an. Sind sie erfolgreich, soll es gut sein. Sind sie es nicht, hat er Zeit gewonnen, um zuerst Saddam zu verjagen. Dann wird auch Nordkorea nicht mit Konzilianz rechnen dürfen. Denn es geht in beiden Fällen nicht um Öl, sondern um Massenvernichtungswaffen. Das Öl verleiht Saddam nur ein zusätzliches Erpressungspotenzial. Mit den Planungen für den Irak-Krieg wurde genau sechs Tage nach den Anschlägen von New York und Washington begonnen. Glaubt jemand ernsthaft, dass damals ein Rohstoff-Krieg in Aussicht genommen wurde?
In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt. Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche „Angstprämie“. Ein Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja Erfahrung.
„Antiwestliches Ressentiment“
Leider ist der Öl-Vorwurf gegen Fakten weitgehend resistent. Er gehört zum Grundbestand transatlantischer Vorurteile. Mit dem Öl-Argument lässt sich sogar Europa diskreditieren, wie der Rechts-Intellektuelle Charles Krauthammer vorführt. Er schreibt, das Verhalten Frankreichs im UN-Sicherheitsrat werde von „Öl-Interessen“ geprägt. Vorsichtshalber fragt er nicht nach, ob Frankreich auch lautere Motive hat und die Legitimität eines Krieges sicherstellen will.
In Deutschland lebt der Vorwurf des kalten Materialismus seit den Tagen der linken Rebellion unverwüstlich fort, freilich auf Amerika gemünzt. Er ist zum „zentralen Bestandteil antiwestlichen Ressentiments“ geworden, wie Dan Diner in seinem jüngsten Buch Feindbild Amerika schreibt. Im Protest gegen den Golfkrieg wurde 1990 „Blut für Öl“ zum Schlachtruf. Diesen Vorwurf vermochte nicht mal der Kriegsverlauf zu erschüttern: Die Amerikaner, angeblich des Öls wegen gekommen, haben Iraks Ölfelder gar nicht eingenommen.
Trotzdem erlebt der Verdacht 1993 seine Wiedergeburt, als sich die Amerikaner anschicken, im öllosen Somalia gegen Hunger und Warlords anzugehen. Prompt findet sich im Stern das Gerücht, US-Ölkonzerne hätten dort die „reichsten Ölfelder des arabisch-afrikanischen Tales“ entdeckt. Leider ist aus der Erschließung trotz US-Truppen nichts geworden, sonst wäre Somalia heute reich. Und nun der Irak-Feldzug: Das Weiße Haus kann die Mär vom lupenreinen Ölkrieg tagtäglich zu widerlegen versuchen – vergebens.
Nein, Bushs riskante Nahost-Politik hat eine schlagkräftigere Kritik verdient. Eine, die amerikanische Außenpolitik nicht auf zwei Buchstaben reduziert. Das Problem ist nicht der Regimewechsel, obwohl ein bisschen mehr Demokratie nicht nur Arabien, sondern der ganzen Welt gut täte. Das Problem ist der Krieg als Mittel. Einen Krieg zu beginnen ist einfacher, als den Frieden zu gewinnen.
(c) DIE ZEIT 05/2003
Amerika, du machst es besser.
Warum Juden in aller Welt lieber auf die US-Armee vertrauen als auf Friedensbewegungen
Von Natan Sznaider
Worüber können heute zwei Freunde streiten, die sich sonst im Politischen über alles einig sind? Wenn der eine Jude ist und der andere nicht, dann sicher nur über Amerika. Dann werden aus zwei liberalen Menschen Kampfhähne. „Amerika bricht alle internationalen Gesetze, ist ein Imperialist, es geht doch nur ums Öl, dieser Bush ist doch so primitiv!“ – „Wir“ müssen uns dagegen wehren. Aus der jüdischen Ecke kann man nur noch verhalten reagieren.
Wie soll man seine Gefühle erklären, ohne sich selbst in einem ethnischen Essenzialismus zu verlieren? Kann es so etwas wie eine jüdische Einstellung zu Amerika überhaupt geben? Wie erklärt man es, dass Amerika für Befreiung steht – und dann nicht versteht, warum gerade Deutsche das nicht verstehen, und bei dem Gedanken erzittert, dass sie es nicht verstehen wollen?
Wie erklärt man es, dass man als Jude gerade in Amerika am leichtesten atmen kann? Amerika war und ist für viele Juden immer schon das „goldene Land“, das wahre Zion, wo Milch und Honig für sie fließen können. Der wahrhaftig sicherste Ort für Juden in dieser Welt, ein Land, wo kürzlich der Jude Joseph Lieberman es beinah geschafft hätte, Vizepräsident zu werden. Amerikanischer Humor ist auch jüdischer Humor, nicht nur wegen Woody Allen und Lenny Bruce. Das Great American Songbook wäre ohne George und Ira Gershwin sowie Irving Berlin nicht denk- und hörbar.
Es ist kein Zufall, dass viele Juden, falls es ihnen besonders gut geht, einfach „Amerika“ sagen. In keinem Land der Welt haben Juden es so weit bringen können wie in Amerika – ja sogar so weit, dass es dem antijüdischen Ressentiment erlaubt ist, von „jüdisch kontrollierten Machtzentralen wie den Medien zu reden“. Aber selbst davor schaudert es einen nicht, sondern man nimmt es mit heimlichem Stolz wahr und wünschte, es wäre so. Daher sind im Bewusstsein vieler Juden die Angriffe gegen Amerika gleichzeitig Angriffe gegen Juden.
Geht man durch deutsche Städte, sieht man, dass die am strengsten bewachten Gebäude jüdische und amerikanische Einrichtungen sind. Nur Zufall? Wie erklärt man einem Freund, man teile im Fall des Irak ein Bauchgefühl mit Amerikanern? Wenn man meint, dass sich im Irak etwas zusammenbraut, was mit sozialpädagogischem Dialog nicht aus der Welt zu schaffen ist? Dass man Stellung beziehen und sich sogar über internationale Vereinbarungen hinwegsetzen möge, da diese Vereinbarungen im Ernstfall schon mal versagten?
Wer sich alles so am Öl berauscht
Man hört sich argumentieren, sagt Dinge, die man als Liberaler eigentlich nicht von sich hören möchte. Man sagt: „Nur Amerika kann uns beschützen“, denn Amerika ist vielleicht das jüdischste Land auf der Welt, vielleicht sogar jüdischer als Israel. Denn in Amerika muss man sich nicht assimilieren; es gibt keinen amerikanischen Essenzialismus, dem man sich anpassen muss. In Amerika ist man Vergangenheit (wo man herkommt) und Gegenwart (Verfassungspatriot) zugleich. Da der Assimilationsdruck oft geringer und der Fortbestand kultureller Identitäten im Rahmen multikultureller Konzeptionen legitim ist, muss sich die Identität von Juden und anderen Gruppen nicht unbedingt durch ihre Verbindung zum Heimatland definieren. Keiner schwafelt von Integration; Leben in der Diaspora ist Leben in der ständigen Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus. Zu universal, um partikular und zu partikular, um universal zu sein. So typisch amerikanisch und am Ende vielleicht doch auch „typisch jüdisch“? Kann man so etwas seinem deutschen liberalen Freund erklären, der doch sein ganzes Leben lang versuchte, sich aus dem verschmähten Partikularismus zu befreien, und nun gar nicht verstehen will, dass man sein typisch jüdisches Schicksal lieber der amerikanischen Armee als der deutschen Friedensbewegung anvertrauen will?
Dann liest man die täglichen Angriffe auf Amerika in der Presse, geht zu Veranstaltungen, auf denen Dan Diner sein neues Buch Feindbild Amerika vorstellt. Er tut es zusammen mit Philippe Roget, der in seinem Buch L’Ennemi Américain deutschen Antiamerikanisten den Spiegel der französischen Amerikagegner vorhält. Und dann raucht es wieder im Publikum: Amerika als Kriegshetzer, Imperialist, Amerika ist vulgär, materialistisch, typisch Hollywood, alles aufs Geld reduzierend.
Und dann das Argument der Argumente: Öl. Es geht doch nur um Öl. Öl als magischer Schlüssel zur Erklärung der Welt. Öl als Sesam, öffne dich. Schwer zu verstehen, warum dieses Wort immer mit erotisch verklärtem Blick ausgesprochen wird. Wer Öl sagt, kann sich schick antiimperialistisch und antiglobal gebärden. Noch mehr reizt das pure Wort. Öl ist Geld. Und Geld ist böse, ist Entfremdung und typisch jüdisch. Es ist nie schwer gefallen, diesen Entfremder zu personalisieren. Wir alle wissen um die Identifizierung der Juden mit Geld, und wir wissen, wie diese Identifizierung auf Amerika und die Amerikaner projiziert wurde.
Natürlich, so was sagt man nicht, denn man darf ja nicht mit der Antisemitismuskeule kommen. So was kann Ärger geben, und man will es ja auch niemandem unterstellen. Wenn man es doch so direkt tut wie Dan Diner in seinem Buch, dann ist klar, dass man das „typisch jüdisch“ zurückbekommt. Denn Diner – und auch Henryk Broder – gehören zu den wenigen jüdischen Intellektuellen, die es klar und deutlich aussprechen: „Hinter eurem Antiamerikanismus verbirgt sich mehr schlecht als recht der alte, schon müde Antisemitismus, der ja auch nichts anderes ist, als sich gegen die pluralistische Moderne zu stellen.“ Und wenn Diner dann „das Prinzip Amerika“ als das neue „Prinzip Hoffnung“ deklariert und behauptet, die amerikanische Flagge habe die rote als Symbol der Freiheit abgelöst, dann kann die liberale Elite nicht mehr mitmachen. In der Tat mag das Argument gerade in Zeiten, in denen die amerikanische Kultur wirklich über die alte europäische Hochkultur gesiegt hat, etwas antiquiert anmuten. Aber es trifft den Nerv der Eliten. Gerade die liberale Elite will sich das nicht vorwerfen lassen, da Antisemitismus eben irrational und tabu ist, aber gegen Amerika zu sein, das ist was anderes.
Kann man es ihr vorwerfen? Warum soll man nicht sagen dürfen, dass die Amis nur ans Öl denken und die Welt beherrschen wollen? Und vielleicht tragen sie für den 11. September eine Mitschuld? Was hat denn das mit Juden zu tun? Hat es nun mal. Und das ist genau das, was Diner seinem Publikum in Elmau, jenem Ort, wo sich die liberale Elite mit Kulturkonservativen zum gemeinsamen Denken trifft, ins Gesicht sagt. Gerade nach solchen Veranstaltungen ist das Bedürfnis, unter Juden bleiben zu wollen, wohl am stärksten.
So stehen sich der Antiamerikanismus und der Antiantiamerikanismus als Vertreterdebatten unversöhnlich gegenüber: „Es muss doch in diesem Land wieder möglich sein…“ Gewiss doch. Für seine Feinde ist Amerika vor dem Hintergrund des derzeitigen Stadiums der Globalisierung ein Repräsentant des „Kosmopolitischen“, das einst mit den Juden assoziiert wurde. Um dies zu erkennen, genügt ein Blick auf die Ähnlichkeiten zwischen Antiamerikanismus und Antisemitismus, die häufig beide vereint im Diskurs der Globalisierungsgegnerschaft anzutreffen sind. Diesen Antiamerikanern will man sagen, dass einem ihre Argumente bekannt vorkommen. Aber sie verstehen es nicht. „Gegen Juden? Ach was. Vielleicht Kritik an Israel, aber die ist doch berechtigt, oder?“ Den Vorwurf des Antisemitismus werden die Antiamerikaner entrüstet von sich weisen, denn deren Kritik beruht ja – ja, worauf?
Es geht eben nicht nur um Amerika. Das neue Europa gründet sich durch Abgrenzung zu anderen. Amerika dient als Spiegel, so wie in den Debatten der vergangenen Monate die Türkei als Spiegel diente. Man grenzt sich von den Asiaten und den Muslimen ab, indem man der Türkei den Eintritt nach Europa verweigert. Abgrenzungen nach außen sind in einer globalen Zeit, wo innen und außen nicht mehr zu unterscheiden sind, gleichzeitig Abgrenzungen im Inneren. Die äußere Abgrenzung zur Türkei, die auch eine Abgrenzung zu Muslimen nach innen bedeutet, wird früher oder später auch die Juden erreichen. Und die spüren das. Bei dem anderen Spiegel, bei Amerika, wird das noch klarer. Wenn antiamerikanische Rhetorik antijüdischer zu sehr ähnelt, dann muss man es „persönlich“ nehmen.
Es bleibt die Frage, ob Europa ohne Amerika überhaupt existiert. Kann man sich ein alternatives Europa – ressentimentfrei – überhaupt vorstellen? Anders gefragt: Wie kann ein kosmopolitisches Europa entstehen, das ohne antiamerikanische Ressentiments auskommt? Kosmopolitismus nicht als abstrakte Philosophie, sondern als gelebte Praxis, die in den Herzen der Menschen verwurzelt ist? Damit sollen universale Werte gemeint sein, die die Menschen gefühlsmäßig erfassen und nicht bloß abstrakte Philosophie sind. Ironischerweise ist es das, was die Amerikaner Pragmatismus nennen. Moderner Kosmopolitismus beginnt da, wo die Staatssouveränität endet. Das höchste Gut sind menschliches Wohlsein und die Pflicht, dem Leiden anderer nicht gleichgültig gegenüber zu stehen. Nicht mehr Zuschauer bleiben und alles daransetzen, das Sterben Unschuldiger zu vermeiden. Darauf beruht die kosmopolitische Moral der Menschenrechtspolitik und der humanitären Intervention.
Keine Angst vor Utopien!
Wenn die Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert von kosmopolitischen Bürgern sprachen, bezogen sie sich auf Weltbürger, deren Geburtsort reiner Zufall war und deren bestimmende Gruppenzugehörigkeit in einer universellen Gemeinschaft im Geiste bestand. Es gäbe viel über dieses Zugehörigkeitsgefühl zu sagen. Es fordert für alles Verantwortung, wo auch immer in der Welt. In seinen Auswirkungen zu Ende gedacht, führt es zur Schaffung internationaler Gesetze und Institutionen, um diese Prinzipien zu garantieren.
In unseren globalen Zeiten brauchen wir eine Vorstellung von Staatsbürgertum, das auf einem Ethos individueller Selbstverwirklichung und Leistung gegründet ist. Amerika kann diesen Kosmopolitismus symbolisieren, obwohl es ihn manchmal selbst vergisst. Und man ist sich gerade in Amerika des Gefälles zwischen Ideal und Wirklichkeit sehr bewusst, was oft von „wohlmeinenden“ Kritikern außerhalb Amerikas übersehen wird. Im jüdischen Gedächtnis ist diese Symbolik stark verankert. Amerika ist auch eine Gesellschaft der Außenseiter, der Einwanderer, der Flüchtlinge. Darum konnten Juden dort so gut Fuß fassen. Es symbolisiert Pluralismus, und das auch in seiner religiösen Bedeutung.
Jeder Angriff auf Amerika wird daher als Angriff auf das eigene Existenzgefühl verstanden. Es kann gar nicht anders verstanden werden. Wenn die Welt langsam zu Amerika wird, kann das für Juden nur Hoffnung bedeuten, denn Amerika verteidigt letzten Endes auch die Freiheit, Antiamerikaner zu sein. Wenn es heute überhaupt einen globalen Konsens gibt, der in Demokratie, offenen Märkten und Menschenrechten erstrebenswerte Ziele sieht, dann hat das sicher mit den Zielen selbst zu tun, aber auch damit, dass sie Teil des amerikanischen Machtanspruchs sind. Also: Keine Angst vor Utopien!
Natan Sznaider lehrt Soziologie am Academic College in Tel Aviv, Israel. Zurzeit arbeitet er am Institut für Soziologie der Universität München. Zuletzt erschien von ihm zusammen mit Daniel Levy und Ulrich Beck (Hrsg.): „Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust“ (Suhrkamp Verlag)
(c) DIE ZEIT 05/2003
n paar nette Artikel:
Die Mär vom Ölkrieg
Falsche Argumente gegen einen gefahrvollen Waffengang
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Eine immer junge These macht wieder Karriere: In Wahrheit sei das Öl der Treibstoff des drohenden Krieges. Eine Allianz aus Kapital und Kanonen, die „Achse des Öls“, mache sich auf, den Irak zur amerikanischen Tankstelle auszubauen, um den Sprit-Preis auf Dauer niedrig zu halten. Deshalb ruft von links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“ Von rechts geißelt Jürgen Todenhöfer die „rohstoffpolitische Kolonisierung“ des Irak. Auf dem Titelblatt des Spiegels wird eine Kreuzung aus Maschinengewehr und Zapfhahn zum Symbol Amerikas. Keine der Großdemonstrationen vom Wochenende kam ohne den Slogan „Blut für Öl“ aus.
Der Charme der Ölkrieg-Theorie besteht darin, dass er so einleuchtend wirkt. Denn niemand will sich mit der Behauptung lächerlich machen, Öl sei bei einem Krieg inmitten von Ölfeldern bedeutungslos. Ein jeder ahnt, dass die Konzerne (nicht nur die amerikanischen) bereits um die Bohrrechte im neuen Öldorado buhlen. Wer im meinungsbunten Washington lange genug sucht, wird schon jemanden finden, der zitierfähig behauptet, die Neuverteilung der Lizenzen sei nicht Folge, sondern Motiv des heraufziehenden Krieges. Schließlich regierten im Weißen Haus die Öl-Männer Bush und Cheney. Alles klar?
Vorbei: Schonzeit für die Saudis
Das Problem ist bloß, dass diese verschwörerische Lesart die große Wende der amerikanischen Politik nach dem 11. September ignoriert. Zuvor hatte ein ebenso stiller wie dubioser Pakt das Verhältnis zum wichtigsten Lieferanten am Golf regiert: Die Saudis pumpen Öl zu moderaten Preisen, und die Amerikaner stützen dafür die korrupte Prinzengarde. Dieser Deal ist mit den Türmen des World Trade Center zusammengebrochen. Stattdessen wächst die Einsicht, dass die traditionelle Nahost-Politik in der Sackgasse steckt. Politiker aller Couleur glauben jetzt, dass Terror gebiert, wer im Nahen Osten doppelzüngig Demokratie predigt und Autokratie fördert. So ist das gewaltige Missionsprojekt der Demokratisierung Arabiens entstanden. Ein herkulisches Unternehmen, das dem Glauben entspringt, nur gute Demokraten seien gute Partner. Diese Vision sehen Arabiens Alleinherrscher zu Recht als Bedrohung. Sie stellt einen radikalen Bruch dar: Idealpolitik ersetzt Realpolitik. Es ist, als wäre Woodrow Wilson wieder auferstanden, der die Welt nach 1918 „safe for democracy“ machen wollte.
Die Ent-Saddamisierung des Irak ist Teil dieses Projekts. Es wird aus der Angst geboren und nicht aus der Gier – aus der Asche der Wolkenkratzer, nicht aus Bauzeichnungen für Bohrtürme. Zum Gemeingut gehört in Washington die Befürchtung, beim nächsten Anschlag würde es nicht bei zwei Bürotürmen bleiben. Fast sicher wären dann Massenvernichtungswaffen im Spiel. Deshalb hat Amerika die Jagd auf Diktatoren mit solchen Waffen eröffnet. Deshalb wird der Abwehrkampf zu einer Präventionspolitik, der jedes Mittel recht zu sein scheint. Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht.
Diese Politik, die in ihrem Bekehrungsdrang bisweilen obsessiv wirkt, wirft viele quälende Fragen auf: Ist die Demokratisierung Arabiens von außen überhaupt möglich? Was sind die Grenzen eines Universalismus, der auf Panzerketten daherkommt? Ist Präventivkrieg auf Verdacht legitim? Es ist diese neue Außenpolitik, ihre Radikalität und ihr Hang zur Grenzverletzung, die nach Diskussion geradezu schreit. Doch Amerika zusätzlich sinistere Motive zu unterstellen, führt in die Irre. Die schrillsten Kritiker wollen Amerika zugleich Materialismus (Öl!) und Moralismus (Achse des Bösen!) vorwerfen. Beides geht aber schon logisch nicht zusammen.
Seit einigen Wochen verleiht die Nordkorea-Krise dem Öl-Argument scheinbar neuen Auftrieb. Da gibt es neben dem Irak ein weiteres Land – diktatorisch geführt, feindlich gesinnt –, das Massenvernichtungswaffen baut. Nordkorea soll aber nicht mit Krieg überzogen werden? Weil dort kein Öl sprudelt!, schallt es zurück.
Merkwürdig, wie Amerikas Konservative noch immer unterschätzt werden. Natürlich weiß auch George Bush, dass er mit unterschiedlicher Elle misst. Aber ihm ist klar, dass er zwei Kriege gleichzeitig nicht riskieren darf. Deshalb bietet er Gespräche mit den Nordkoreanern an. Sind sie erfolgreich, soll es gut sein. Sind sie es nicht, hat er Zeit gewonnen, um zuerst Saddam zu verjagen. Dann wird auch Nordkorea nicht mit Konzilianz rechnen dürfen. Denn es geht in beiden Fällen nicht um Öl, sondern um Massenvernichtungswaffen. Das Öl verleiht Saddam nur ein zusätzliches Erpressungspotenzial. Mit den Planungen für den Irak-Krieg wurde genau sechs Tage nach den Anschlägen von New York und Washington begonnen. Glaubt jemand ernsthaft, dass damals ein Rohstoff-Krieg in Aussicht genommen wurde?
In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt. Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche „Angstprämie“. Ein Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja Erfahrung.
„Antiwestliches Ressentiment“
Leider ist der Öl-Vorwurf gegen Fakten weitgehend resistent. Er gehört zum Grundbestand transatlantischer Vorurteile. Mit dem Öl-Argument lässt sich sogar Europa diskreditieren, wie der Rechts-Intellektuelle Charles Krauthammer vorführt. Er schreibt, das Verhalten Frankreichs im UN-Sicherheitsrat werde von „Öl-Interessen“ geprägt. Vorsichtshalber fragt er nicht nach, ob Frankreich auch lautere Motive hat und die Legitimität eines Krieges sicherstellen will.
In Deutschland lebt der Vorwurf des kalten Materialismus seit den Tagen der linken Rebellion unverwüstlich fort, freilich auf Amerika gemünzt. Er ist zum „zentralen Bestandteil antiwestlichen Ressentiments“ geworden, wie Dan Diner in seinem jüngsten Buch Feindbild Amerika schreibt. Im Protest gegen den Golfkrieg wurde 1990 „Blut für Öl“ zum Schlachtruf. Diesen Vorwurf vermochte nicht mal der Kriegsverlauf zu erschüttern: Die Amerikaner, angeblich des Öls wegen gekommen, haben Iraks Ölfelder gar nicht eingenommen.
Trotzdem erlebt der Verdacht 1993 seine Wiedergeburt, als sich die Amerikaner anschicken, im öllosen Somalia gegen Hunger und Warlords anzugehen. Prompt findet sich im Stern das Gerücht, US-Ölkonzerne hätten dort die „reichsten Ölfelder des arabisch-afrikanischen Tales“ entdeckt. Leider ist aus der Erschließung trotz US-Truppen nichts geworden, sonst wäre Somalia heute reich. Und nun der Irak-Feldzug: Das Weiße Haus kann die Mär vom lupenreinen Ölkrieg tagtäglich zu widerlegen versuchen – vergebens.
Nein, Bushs riskante Nahost-Politik hat eine schlagkräftigere Kritik verdient. Eine, die amerikanische Außenpolitik nicht auf zwei Buchstaben reduziert. Das Problem ist nicht der Regimewechsel, obwohl ein bisschen mehr Demokratie nicht nur Arabien, sondern der ganzen Welt gut täte. Das Problem ist der Krieg als Mittel. Einen Krieg zu beginnen ist einfacher, als den Frieden zu gewinnen.
(c) DIE ZEIT 05/2003
Amerika, du machst es besser.
Warum Juden in aller Welt lieber auf die US-Armee vertrauen als auf Friedensbewegungen
Von Natan Sznaider
Worüber können heute zwei Freunde streiten, die sich sonst im Politischen über alles einig sind? Wenn der eine Jude ist und der andere nicht, dann sicher nur über Amerika. Dann werden aus zwei liberalen Menschen Kampfhähne. „Amerika bricht alle internationalen Gesetze, ist ein Imperialist, es geht doch nur ums Öl, dieser Bush ist doch so primitiv!“ – „Wir“ müssen uns dagegen wehren. Aus der jüdischen Ecke kann man nur noch verhalten reagieren.
Wie soll man seine Gefühle erklären, ohne sich selbst in einem ethnischen Essenzialismus zu verlieren? Kann es so etwas wie eine jüdische Einstellung zu Amerika überhaupt geben? Wie erklärt man es, dass Amerika für Befreiung steht – und dann nicht versteht, warum gerade Deutsche das nicht verstehen, und bei dem Gedanken erzittert, dass sie es nicht verstehen wollen?
Wie erklärt man es, dass man als Jude gerade in Amerika am leichtesten atmen kann? Amerika war und ist für viele Juden immer schon das „goldene Land“, das wahre Zion, wo Milch und Honig für sie fließen können. Der wahrhaftig sicherste Ort für Juden in dieser Welt, ein Land, wo kürzlich der Jude Joseph Lieberman es beinah geschafft hätte, Vizepräsident zu werden. Amerikanischer Humor ist auch jüdischer Humor, nicht nur wegen Woody Allen und Lenny Bruce. Das Great American Songbook wäre ohne George und Ira Gershwin sowie Irving Berlin nicht denk- und hörbar.
Es ist kein Zufall, dass viele Juden, falls es ihnen besonders gut geht, einfach „Amerika“ sagen. In keinem Land der Welt haben Juden es so weit bringen können wie in Amerika – ja sogar so weit, dass es dem antijüdischen Ressentiment erlaubt ist, von „jüdisch kontrollierten Machtzentralen wie den Medien zu reden“. Aber selbst davor schaudert es einen nicht, sondern man nimmt es mit heimlichem Stolz wahr und wünschte, es wäre so. Daher sind im Bewusstsein vieler Juden die Angriffe gegen Amerika gleichzeitig Angriffe gegen Juden.
Geht man durch deutsche Städte, sieht man, dass die am strengsten bewachten Gebäude jüdische und amerikanische Einrichtungen sind. Nur Zufall? Wie erklärt man einem Freund, man teile im Fall des Irak ein Bauchgefühl mit Amerikanern? Wenn man meint, dass sich im Irak etwas zusammenbraut, was mit sozialpädagogischem Dialog nicht aus der Welt zu schaffen ist? Dass man Stellung beziehen und sich sogar über internationale Vereinbarungen hinwegsetzen möge, da diese Vereinbarungen im Ernstfall schon mal versagten?
Wer sich alles so am Öl berauscht
Man hört sich argumentieren, sagt Dinge, die man als Liberaler eigentlich nicht von sich hören möchte. Man sagt: „Nur Amerika kann uns beschützen“, denn Amerika ist vielleicht das jüdischste Land auf der Welt, vielleicht sogar jüdischer als Israel. Denn in Amerika muss man sich nicht assimilieren; es gibt keinen amerikanischen Essenzialismus, dem man sich anpassen muss. In Amerika ist man Vergangenheit (wo man herkommt) und Gegenwart (Verfassungspatriot) zugleich. Da der Assimilationsdruck oft geringer und der Fortbestand kultureller Identitäten im Rahmen multikultureller Konzeptionen legitim ist, muss sich die Identität von Juden und anderen Gruppen nicht unbedingt durch ihre Verbindung zum Heimatland definieren. Keiner schwafelt von Integration; Leben in der Diaspora ist Leben in der ständigen Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus. Zu universal, um partikular und zu partikular, um universal zu sein. So typisch amerikanisch und am Ende vielleicht doch auch „typisch jüdisch“? Kann man so etwas seinem deutschen liberalen Freund erklären, der doch sein ganzes Leben lang versuchte, sich aus dem verschmähten Partikularismus zu befreien, und nun gar nicht verstehen will, dass man sein typisch jüdisches Schicksal lieber der amerikanischen Armee als der deutschen Friedensbewegung anvertrauen will?
Dann liest man die täglichen Angriffe auf Amerika in der Presse, geht zu Veranstaltungen, auf denen Dan Diner sein neues Buch Feindbild Amerika vorstellt. Er tut es zusammen mit Philippe Roget, der in seinem Buch L’Ennemi Américain deutschen Antiamerikanisten den Spiegel der französischen Amerikagegner vorhält. Und dann raucht es wieder im Publikum: Amerika als Kriegshetzer, Imperialist, Amerika ist vulgär, materialistisch, typisch Hollywood, alles aufs Geld reduzierend.
Und dann das Argument der Argumente: Öl. Es geht doch nur um Öl. Öl als magischer Schlüssel zur Erklärung der Welt. Öl als Sesam, öffne dich. Schwer zu verstehen, warum dieses Wort immer mit erotisch verklärtem Blick ausgesprochen wird. Wer Öl sagt, kann sich schick antiimperialistisch und antiglobal gebärden. Noch mehr reizt das pure Wort. Öl ist Geld. Und Geld ist böse, ist Entfremdung und typisch jüdisch. Es ist nie schwer gefallen, diesen Entfremder zu personalisieren. Wir alle wissen um die Identifizierung der Juden mit Geld, und wir wissen, wie diese Identifizierung auf Amerika und die Amerikaner projiziert wurde.
Natürlich, so was sagt man nicht, denn man darf ja nicht mit der Antisemitismuskeule kommen. So was kann Ärger geben, und man will es ja auch niemandem unterstellen. Wenn man es doch so direkt tut wie Dan Diner in seinem Buch, dann ist klar, dass man das „typisch jüdisch“ zurückbekommt. Denn Diner – und auch Henryk Broder – gehören zu den wenigen jüdischen Intellektuellen, die es klar und deutlich aussprechen: „Hinter eurem Antiamerikanismus verbirgt sich mehr schlecht als recht der alte, schon müde Antisemitismus, der ja auch nichts anderes ist, als sich gegen die pluralistische Moderne zu stellen.“ Und wenn Diner dann „das Prinzip Amerika“ als das neue „Prinzip Hoffnung“ deklariert und behauptet, die amerikanische Flagge habe die rote als Symbol der Freiheit abgelöst, dann kann die liberale Elite nicht mehr mitmachen. In der Tat mag das Argument gerade in Zeiten, in denen die amerikanische Kultur wirklich über die alte europäische Hochkultur gesiegt hat, etwas antiquiert anmuten. Aber es trifft den Nerv der Eliten. Gerade die liberale Elite will sich das nicht vorwerfen lassen, da Antisemitismus eben irrational und tabu ist, aber gegen Amerika zu sein, das ist was anderes.
Kann man es ihr vorwerfen? Warum soll man nicht sagen dürfen, dass die Amis nur ans Öl denken und die Welt beherrschen wollen? Und vielleicht tragen sie für den 11. September eine Mitschuld? Was hat denn das mit Juden zu tun? Hat es nun mal. Und das ist genau das, was Diner seinem Publikum in Elmau, jenem Ort, wo sich die liberale Elite mit Kulturkonservativen zum gemeinsamen Denken trifft, ins Gesicht sagt. Gerade nach solchen Veranstaltungen ist das Bedürfnis, unter Juden bleiben zu wollen, wohl am stärksten.
So stehen sich der Antiamerikanismus und der Antiantiamerikanismus als Vertreterdebatten unversöhnlich gegenüber: „Es muss doch in diesem Land wieder möglich sein…“ Gewiss doch. Für seine Feinde ist Amerika vor dem Hintergrund des derzeitigen Stadiums der Globalisierung ein Repräsentant des „Kosmopolitischen“, das einst mit den Juden assoziiert wurde. Um dies zu erkennen, genügt ein Blick auf die Ähnlichkeiten zwischen Antiamerikanismus und Antisemitismus, die häufig beide vereint im Diskurs der Globalisierungsgegnerschaft anzutreffen sind. Diesen Antiamerikanern will man sagen, dass einem ihre Argumente bekannt vorkommen. Aber sie verstehen es nicht. „Gegen Juden? Ach was. Vielleicht Kritik an Israel, aber die ist doch berechtigt, oder?“ Den Vorwurf des Antisemitismus werden die Antiamerikaner entrüstet von sich weisen, denn deren Kritik beruht ja – ja, worauf?
Es geht eben nicht nur um Amerika. Das neue Europa gründet sich durch Abgrenzung zu anderen. Amerika dient als Spiegel, so wie in den Debatten der vergangenen Monate die Türkei als Spiegel diente. Man grenzt sich von den Asiaten und den Muslimen ab, indem man der Türkei den Eintritt nach Europa verweigert. Abgrenzungen nach außen sind in einer globalen Zeit, wo innen und außen nicht mehr zu unterscheiden sind, gleichzeitig Abgrenzungen im Inneren. Die äußere Abgrenzung zur Türkei, die auch eine Abgrenzung zu Muslimen nach innen bedeutet, wird früher oder später auch die Juden erreichen. Und die spüren das. Bei dem anderen Spiegel, bei Amerika, wird das noch klarer. Wenn antiamerikanische Rhetorik antijüdischer zu sehr ähnelt, dann muss man es „persönlich“ nehmen.
Es bleibt die Frage, ob Europa ohne Amerika überhaupt existiert. Kann man sich ein alternatives Europa – ressentimentfrei – überhaupt vorstellen? Anders gefragt: Wie kann ein kosmopolitisches Europa entstehen, das ohne antiamerikanische Ressentiments auskommt? Kosmopolitismus nicht als abstrakte Philosophie, sondern als gelebte Praxis, die in den Herzen der Menschen verwurzelt ist? Damit sollen universale Werte gemeint sein, die die Menschen gefühlsmäßig erfassen und nicht bloß abstrakte Philosophie sind. Ironischerweise ist es das, was die Amerikaner Pragmatismus nennen. Moderner Kosmopolitismus beginnt da, wo die Staatssouveränität endet. Das höchste Gut sind menschliches Wohlsein und die Pflicht, dem Leiden anderer nicht gleichgültig gegenüber zu stehen. Nicht mehr Zuschauer bleiben und alles daransetzen, das Sterben Unschuldiger zu vermeiden. Darauf beruht die kosmopolitische Moral der Menschenrechtspolitik und der humanitären Intervention.
Keine Angst vor Utopien!
Wenn die Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert von kosmopolitischen Bürgern sprachen, bezogen sie sich auf Weltbürger, deren Geburtsort reiner Zufall war und deren bestimmende Gruppenzugehörigkeit in einer universellen Gemeinschaft im Geiste bestand. Es gäbe viel über dieses Zugehörigkeitsgefühl zu sagen. Es fordert für alles Verantwortung, wo auch immer in der Welt. In seinen Auswirkungen zu Ende gedacht, führt es zur Schaffung internationaler Gesetze und Institutionen, um diese Prinzipien zu garantieren.
In unseren globalen Zeiten brauchen wir eine Vorstellung von Staatsbürgertum, das auf einem Ethos individueller Selbstverwirklichung und Leistung gegründet ist. Amerika kann diesen Kosmopolitismus symbolisieren, obwohl es ihn manchmal selbst vergisst. Und man ist sich gerade in Amerika des Gefälles zwischen Ideal und Wirklichkeit sehr bewusst, was oft von „wohlmeinenden“ Kritikern außerhalb Amerikas übersehen wird. Im jüdischen Gedächtnis ist diese Symbolik stark verankert. Amerika ist auch eine Gesellschaft der Außenseiter, der Einwanderer, der Flüchtlinge. Darum konnten Juden dort so gut Fuß fassen. Es symbolisiert Pluralismus, und das auch in seiner religiösen Bedeutung.
Jeder Angriff auf Amerika wird daher als Angriff auf das eigene Existenzgefühl verstanden. Es kann gar nicht anders verstanden werden. Wenn die Welt langsam zu Amerika wird, kann das für Juden nur Hoffnung bedeuten, denn Amerika verteidigt letzten Endes auch die Freiheit, Antiamerikaner zu sein. Wenn es heute überhaupt einen globalen Konsens gibt, der in Demokratie, offenen Märkten und Menschenrechten erstrebenswerte Ziele sieht, dann hat das sicher mit den Zielen selbst zu tun, aber auch damit, dass sie Teil des amerikanischen Machtanspruchs sind. Also: Keine Angst vor Utopien!
Natan Sznaider lehrt Soziologie am Academic College in Tel Aviv, Israel. Zurzeit arbeitet er am Institut für Soziologie der Universität München. Zuletzt erschien von ihm zusammen mit Daniel Levy und Ulrich Beck (Hrsg.): „Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust“ (Suhrkamp Verlag)
(c) DIE ZEIT 05/2003
Wundert es dich, dass ein Antiamerikanismus aufkommt mit Aussagen wie "you are either with us or against us!"
Tut mir leid Herr Bush, aber es gibt nicht nur schwarz und weiß, für uns und gegen uns, gut und böse.
Zum Krieg gegen den Terrorismus: Man sollte Terrorismus zuerst einmal definieren, bevor man dagegen Krieg führt. In Iraq wird nämlich mit einer Gruppe namens Al Dawaa (glaub die schreibt man so) zusammengearbeitet, die früher gegen die USA kämpften (unter anderem) und daher als Terroristen bezeichnet wurden - und jetzt als plötzlich zu Freiheitskämpfern werden. (schon sehr bequem oder? Ich stemple einfach jeden, der mir nicht passt als Terrorist ab und schwups die wups weg mit ihm ohne viel Fragen zu stellen)
Wer die Amerikaner komplett verteufelt, liegt allerdings genauso falsch, wie jemand, der sie in höchsten Tönen lobt. Sie haben - wie so ziemlich jeder andere Staat auch - ne Menge Dreck am Stecken und selbst wenn der Krieg aus niederen Motiven geführt wird (wer kann denn schon sagen, wie es wirklich aussieht?), so hat er auch etwas Gutes - Saddam Husaein ist auf jedenfall ein Diktator und ein gefährlicher noch dazu, wenn die Amis keine Sch**** bauen, nachdem sie ihn "abgesetzt" haben, dann war das sicher kein Nachteil. (Wobei ich es wieder einmal äußerst interessant finde, dass die Amis immer die Leute wegräumen müssen, die sie ein paar Jährchen davor eingesetzt haben (Saddam, Osama (hat CIA Training genossen, wenn man Bowling for Collumbine glauben darf) etc.)
Was mich aber am meisten an ihnen stört ist ihre Engstirnigkeit im Bezug auf Umweltpolitik etc. (denn meiner Meinung nach ist dies der einzige "Zweig" der Politik, der wirklich langfristig gesehen zählt) - Ich empfinde es als pervers, Umweltschützer als Exoten bzw. Verrückte zu bezeichnen.
Tut mir leid Herr Bush, aber es gibt nicht nur schwarz und weiß, für uns und gegen uns, gut und böse.
Zum Krieg gegen den Terrorismus: Man sollte Terrorismus zuerst einmal definieren, bevor man dagegen Krieg führt. In Iraq wird nämlich mit einer Gruppe namens Al Dawaa (glaub die schreibt man so) zusammengearbeitet, die früher gegen die USA kämpften (unter anderem) und daher als Terroristen bezeichnet wurden - und jetzt als plötzlich zu Freiheitskämpfern werden. (schon sehr bequem oder? Ich stemple einfach jeden, der mir nicht passt als Terrorist ab und schwups die wups weg mit ihm ohne viel Fragen zu stellen)
Wer die Amerikaner komplett verteufelt, liegt allerdings genauso falsch, wie jemand, der sie in höchsten Tönen lobt. Sie haben - wie so ziemlich jeder andere Staat auch - ne Menge Dreck am Stecken und selbst wenn der Krieg aus niederen Motiven geführt wird (wer kann denn schon sagen, wie es wirklich aussieht?), so hat er auch etwas Gutes - Saddam Husaein ist auf jedenfall ein Diktator und ein gefährlicher noch dazu, wenn die Amis keine Sch**** bauen, nachdem sie ihn "abgesetzt" haben, dann war das sicher kein Nachteil. (Wobei ich es wieder einmal äußerst interessant finde, dass die Amis immer die Leute wegräumen müssen, die sie ein paar Jährchen davor eingesetzt haben (Saddam, Osama (hat CIA Training genossen, wenn man Bowling for Collumbine glauben darf) etc.)
Was mich aber am meisten an ihnen stört ist ihre Engstirnigkeit im Bezug auf Umweltpolitik etc. (denn meiner Meinung nach ist dies der einzige "Zweig" der Politik, der wirklich langfristig gesehen zählt) - Ich empfinde es als pervers, Umweltschützer als Exoten bzw. Verrückte zu bezeichnen.
A
Anzeige
schau mal hier:
meine wird immer .
- Status
- Für weitere Antworten geschlossen.