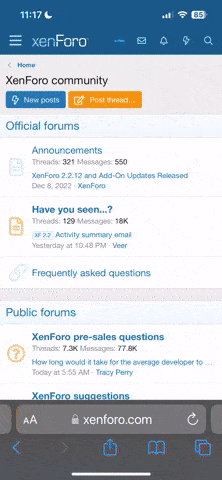Ich stelle den Spiegel Kommentar auch hier nochmal rein, damit ihr sehen könnt daß es,um das Wirtschaftswachstum zu fördern, nicht gerade klug war Rot oder Grün zu wählen.
SPIEGEL-KOMMENTAR
Kanzler ohne Sieg
Von Mathias Müller von Blumencron
Gerhard Schröder hat es geschafft: Mit hauchdünnem Vorsprung rettete er die Macht für Rot-Grün. Doch anders als vor vier Jahren gewann er nicht als Reform-Kanzler, sondern als Instinktpolitiker, der Wasserfluten und Kriegsangst für seine Wiederwahl instrumentalisierte. Nun muss er zeigen, dass er nicht nur Wahlkämpfe führen, sondern ein Land aus der Krise ziehen kann.
So richtig jubeln konnte der Kanzler nicht, sein "wir haben keinen Grund, uns zu verstecken", kam Sonntagabend müde von der Bühne vor der Berliner SPD-Zentrale. Die Enttäuschung über die schweren Verluste seiner Partei stand dem Regierungschef ins Gesicht geschrieben. Schröder kann Kanzler bleiben, die Wahl gewonnen hat er nicht.
Gewonnen hat dagegen der Herausforderer Edmund Stoiber, vor allem in seinem Heimatland, wo er für die CSU eines der besten Ergebnisse bei einer Bundestagswahl seit 1949 erzielte. Gewonnen hat auch Schröders Außenminister, der Grüne Joschka Fischer, dessen Partei auf Bundesebene noch nie so gut abgeschnitten hat. Dass Schröder überhaupt noch regieren kann, hat er alleine seinem bisherigen Vize zu verdanken, Deutschlands beliebtestem Politiker. Dessen Ergebnis rettet dem Sozialdemokraten das Kanzleramt, bewahrte ihn vor der Schmach, der erste Regierungschef zu werden, den die Wähler nach vier Jahren wieder davonjagten. Für Deutschland indes ist der knappe Wahlausgang eines der denkbar ungünstigsten Resultate.
"Mehrheit ist Mehrheit", sagt Schröder angesichts des dünnen Vorsprungs trotzig, und damit hat er zunächst einmal Recht. Konrad Adenauer wurde mit einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen, zum Kanzler gewählt - es folgte eine der erfolgreichsten Amtszeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Auch Helmut Kohl regierte lange mit nur vier Abgeordneten Vorsprung. Doch die Zeiten sind anders.
Geschwächte Partei, geschwächter Kanzler
Das Land steckt in tiefer Krise. In den vergangenen acht Jahren wuchs die Wirtschaft langsamer als in irgendeiner der anderen führenden Industrienationen - außer Japan. Das Schulsystem ist nicht nur marode, sondern auch noch ungerecht - in kaum einem anderen Land bestimmt die soziale Herkunft so sehr über den Bildungserfolg. Noch immer dient das Gesundheitssystem vornehmlich dem Gewinnstreben der Pharmaindustrie, belasten die steigenden Kassenbeiträge Unternehmen und Patienten. Und noch immer gibt es kein Konzept, wie Renten und Sozialausgaben der rasch alternden Republik in Zukunft finanziert werden sollen.
Um den Reformstau zu durchbrechen, bedarf es nicht nur mutiger Ideen, sondern auch stabiler Mehrheiten. Nun stellt eine geschwächte Partei einen geschwächten Kanzler, der zudem in den vergangenen Wochen bewiesen hat, dass er zwar Wahlen retten, nicht aber unbedingt ein Land voranbringen kann.
An der Macht blieb der Kanzler gerade nicht, weil er für die Reform-Agenda das bessere Programm vorweisen konnte. Antworten darauf, wie er Deutschland aus der Krise führen wollte, blieb er ebenso schuldig wie sein Gegner. Überhaupt ging es in den letzten Wochen des langweiligsten Wahlkampfs der Nachkriegsgeschichte nicht um Argumente, um Themen, um Politik. Stattdessen spielten Schröder und seine Helfer skrupellos auf der Klaviatur der Populisten und betrieben Wahlkampf mit Ängsten und Gefühlen.
Innerhalb weniger Wochen gelang es Schröder, die Diskussion von den wichtigen Sachthemen wegzuziehen, bei denen seine Bilanz hoffnungslos aussah. Am Ende war es eine Persönlichkeitswahl, in der Rot-Grün gewinnen konnte, weil Schröder vielen Wählern als der sympathischere Onkel erschien. Das ist kein stabiles Fundament, um den Reformstau zu durchbrechen.
Wahlhilfe aus Washington
Vom Wechsel in die Opposition bewahrt wurde Schröder, weil er unerwartet Wahlhilfe von höheren Mächten bekam. Noch vor zwei Monaten schien die Wahl für SPD und Grüne haushoch verloren. Die Stimmungswende kam mit der Flut, ein Gottesgeschenk für den SPD-Wahlkampf: Die Jahrhundertkatastrophe erlaubte es dem Kanzler, sich plötzlich wieder als Macher zu profilieren, besonders in Ostdeutschland. Der Kanzler in der Schlammwüste - das gab kernige Bilder für den TV-Wahlkampf in den Sommerferien. Das saugte Stimmen von der schon durch den Rücktritt Gregor Gysis von seinem Posten als Berliner Wirtschaftssenator geschwächten PDS. Verdrängt war die Wirtschaftskrise, plötzlich hieß die Losung Solidarität, ein in den vergangenen Jahren fast vergessener ureigener sozialdemokratischer Wert rückte wieder in den Vordergrund.
Der zweite große Wahlhelfer des Kanzlers residiert in irdischen Sphären, im fernen Washington. Die Kriegstreiberei des US-Präsidenten George W. Bush erlaubte es Schröder, sich als Friedensfürst zu profilieren. Gnadenlos nutzte er die Furcht vieler Deutscher vor einem Waffengang. Der Kanzler betrieb Anti-Amerikanismus mit bisher nicht für möglich gehaltener Schärfe und begeisterte damit nicht nur die Jusos, sondern auch PDS-Anhänger und sogar nationalistische Rechte. Mit seinen deutlichen Worten, die das Verhältnis der Deutschen zu den USA und anderen westlichen Partner-Länder erschütterte, punktete der Kanzler bis tief in die Stammwählerschaft der Konservativen.
Vergessen waren die Worte seines Außenministers ("wir haben die Amerikaner nicht zu kritisieren"). Plötzlich war Amerika-Kritik wieder erlaubt, und Schröders Attacken gen Washington wirkten für viele seiner Wähler, als hätte er sich und ihnen endlich den Maulkorb abgerissen, den sie seit dem 11. September hatten tragen müssen. Geschickt, aber skrupellos nutzte er ein verbreitetes und undifferenziertes Ressentiment für die Stimmungsmache zu seinen Gunsten. Dabei lässt sich Kritik an der amerikanischen Regierung auch artikulieren, ohne damit die vielen Millionen Amerikaner zu kränken, die die Deutschen bislang für ihre besten Freunde in Europa hielten.
Der Möllemann-Faktor
Weitere Wahlhelfer wirkten noch näher an der Bundeshauptstadt. Der FDP-Vize Jürgen Möllemann nahm der FDP jede Chance auf ein zweistelliges Ergebnis. Sein Flirt mit dem Antisemitismus verschreckte potenzielle Wähler in Scharen und verwehrte schließlich Stoiber den Einzug ins Kanzleramt an der Spitze einer schwarz-gelben Koalition. Aber auch der Herausforderer selbst agierte unglücklich. Von Beginn an fehlte ihm der Mut, den Kanzler mit klaren Konzepten zu attackieren. Bis heute erklärte er den Wählern nicht, wie er denn nun die Wirtschaftskrise, die er zu seinem Kernthema erkoren hatte, überwinden wolle.
Je mehr der Wahlkampf fortschritt, umso mehr wurde der Herausforderer zum Getriebenen. Der Kanzler präsentierte zum Sommeranfang das Hartz-Papier, Ende August, einen Monat vor der Wahl, kam Stoiber mit seinem Wirtschaftskonzept. Das nahmen ihm selbst Unionsanhänger nicht mehr ab. Der Kanzler sammelte Charme-Punkte, Stoiber versuchte es im TV-Duell mit einem antrainierten, verkrampften und oftmals fehl platzierten Grinsen.
Keine Partei wagte, den Wählern die Wahrheit zu sagen
Doch möglicherweise noch wichtiger als alle externen Faktoren war ein Grundgefühl der Deutschen, das in dem sich andeutenden Krisen-Herbst - Börsenabsturz, Massenentlassungen, Kriegsdrohungen - wieder hervorbrach, und das der Kanzler mit zielsicherem Instinkt aufspürte: Die deutsche Angst.
Keine Partei wagte, den Wählern die Wahrheit zu sagen: dass Überalterung, steigende Sozialabgaben und zunehmende Bürokratisierung das Land abzuwürgen drohen. Und vielleicht wollten es die Wähler auch gar nicht so deutlich wissen. Angst vor Krieg, Angst vor Jobverlust, Angst vor mehr Konkurrenz verdrängten - durchaus verständlich - zunehmend die Reformlust.
Noch vor vier Jahren sehnten sich die Menschen nach Veränderung. Selten waren die Deutschen so reformbereit wie nach den bleiernen Kohl-Jahren - doch Schröder nutzte den Schwung nicht. Nach zaghaften Reform-Versuchen in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit stoppte er mit der Politik der "ruhigen Hand" den Fortschritt. Heute ist der Reformstau in Deutschland teilweise noch dramatischer als vor vier Jahren.
Kampf gegen die Interessenbewahrer
Nun muss der Kanzler zeigen, dass er nicht nur Wahlen gewinnen, sondern auch regieren kann. Vor ihm liegen große Aufgaben, das Konflikt-Potenzial ist gewaltig. Nahezu sämtliche Reformen verlangen harte Schnitte, gegen die es vor allem in den eigenen Reihen jede Menge Interessenbewahrer gibt. Wird sich der Kanzler mit Hauchdünn-Mehrheit wirklich mit Ärzten und Pharmalobbyisten anlegen, oder gar auf höhere Selbstbehalte bei den Krankenkassen drängen, wo ihm schon bisher der Mut dazu fehlte? Wird er sich mit den vielen Lehrern in den eigenen Reihen, aber auch unter seinen Wählern anlegen, um unter den Studienräten für mehr Konkurrenz und Leistungsdruck zu sorgen? Wird er es wagen, mehr Einwanderung zu fordern, damit der Sozialstaat zumindest halbwegs finanzierbar bleibt? Und wird er es wagen, mit mutiger Liberalisierung der Wirtschaft wieder die Luft für Investitionen und Wachstum zu geben, die sie so dringend braucht? Bisher bremste der Kanzler, wenn es etwa darum ging, Selbständigkeit zu erleichtern oder den Niedriglohnsektor auszuweiten, um die boomende Schwarzarbeit zu begrenzen.
Die Reformsehnsucht der Deutschen ist wie weggeblasen, das hat der Regierungs-Chef geschickt erkannt. Eine Mehrheit, so zeigen die Umfragen, empfindet den Begriff derzeit als negativ. Vor vier Jahren hatten die Deutschen Schröder gewählt, weil sie Veränderung wollten. Heute haben die Wähler für ihn gestimmt, weil er vielen als Garant dafür gilt, sie vor großen Veränderungen zu bewahren.
Zu befürchten ist, dass Schröder seine Wähler nicht enttäuschen wird