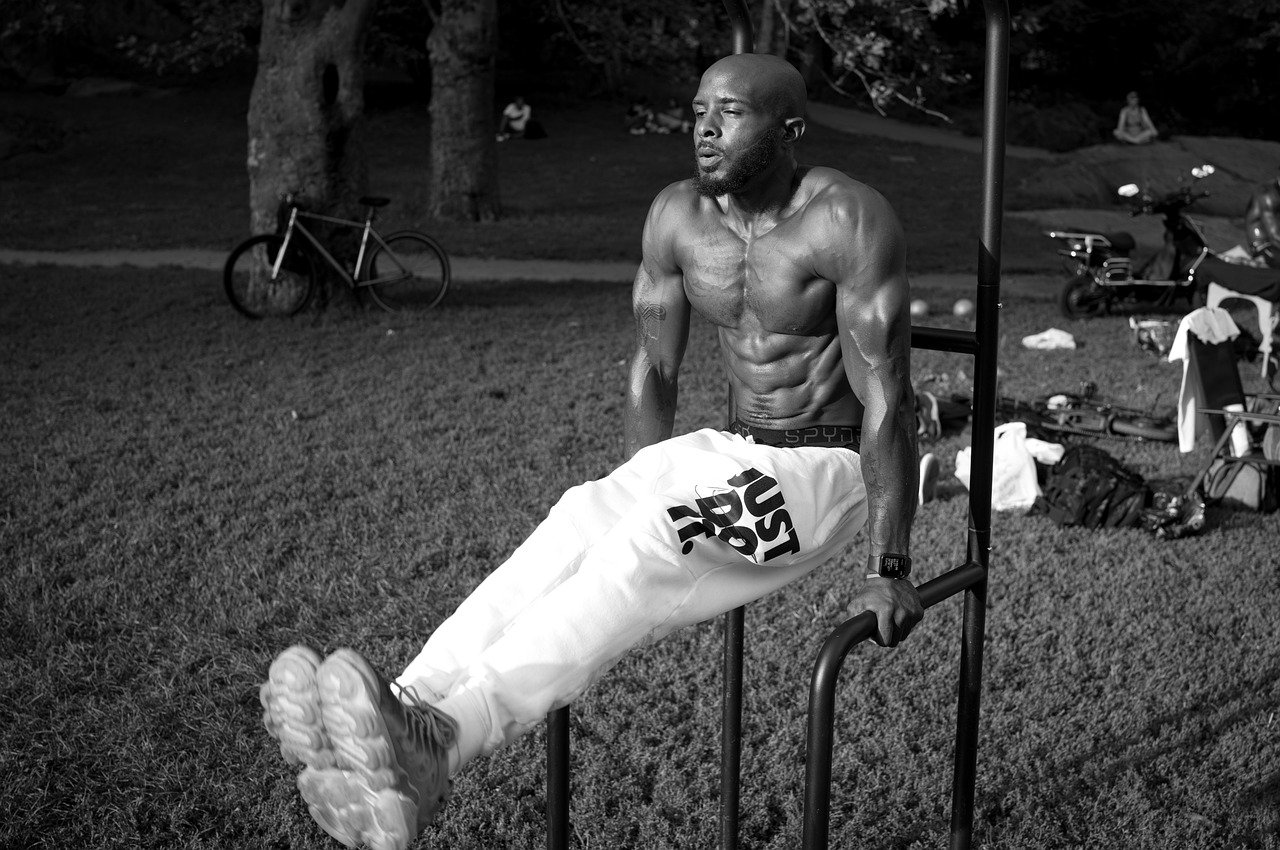In fast jeder Trainerausbildung geht es um Anatomie, Trainingslehre, Kommunikation, Motivation und Sicherheit – aber praktisch nie um Substanzkonsum. Alkohol wird beiläufig erwähnt, Anabolika tauchen als Warnung in einer Randspalte auf, und Cannabis? Kommt schlicht nicht vor. Dabei begegnen Trainer im Alltag längst Mitgliedern, die konsumieren, abhängig sind, aussteigen wollen oder still in einem circulus vitiosus aus Stress, Verdrängung und Rückfall feststecken. Diese Realität ist im Studio präsent, aber im Curriculum tabu.
Ich habe selbst jahrelang als Ausbilder für die Trainerlizenzen A und B gearbeitet und bin dafür quer durch Deutschland gereist. In all diesen Ausbildungen standen Anatomie, Trainingslehre, Didaktik und Technik im Mittelpunkt – körperliche Themen, sauber strukturiert und gut vermittelt. Aber rückblickend fällt mir auf, wie wenig Raum die Psyche bekommen hat und wie komplett das Thema Sucht ausgeklammert wurde.
Damals habe ich mir nichts dabei gedacht, heute erscheint es mir wie eine gefährliche Lücke: Trainer sollen Menschen begleiten, motivieren und stabilisieren, aber auf die Realität von psychischen Belastungen oder Cannabisabhängigkeit wurden wir nie vorbereitet.
Warum Cannabis im Studiokontext unsichtbar bleibt
Ein Grund dafür ist, dass Cannabiskonsum selten offen kommuniziert wird. Viele Mitglieder nutzen Sport als Gegenpol zu Stress, Chaos oder Schlafproblemen – genau jenen Faktoren, die oft auch zum Konsum beitragen. Cannabis wird als „Entspannungsritual“ rationalisiert, als harmlose Gewohnheit dargestellt oder bewusst versteckt. Für Trainer wirkt der Konsum unsichtbar, bis sich das Verhalten eines Mitglieds verändert: unruhiger Schlaf, nachlassende Motivation, schwankende Leistungsfähigkeit, längere Regenerationszeiten und eine gewisse emotionale Abstumpfung.
Weil die Trainerausbildung dafür keine Sensibilität schafft, bleibt der zugrunde liegende Konsum oft unbemerkt. Das führt dazu, dass Fehlinterpretationen überhandnehmen – von „keine Disziplin“ bis „der hat einfach keinen Bock mehr“ –, obwohl in Wahrheit ein psychisches Muster dahintersteckt.
Der circulus vitiosus: Konsum, Verdrängung und Leistungsabfall
Im Kern besteht Cannabisabhängigkeit meist aus einem psychischen Teufelskreis. Konsum reduziert Stress kurzfristig, löst aber keinen einzigen Auslöser. Die ungelösten Konflikte, der Druck, die emotionale Leere oder die Überforderung bleiben bestehen – oft verstärkt durch Schlafstörungen, Appetitprobleme und Antriebslosigkeit, die THC selbst verursacht.
Dadurch wird Training unregelmäßig, Ernährung chaotisch und die Stimmung instabil. Der Rückzug verstärkt wieder den Wunsch nach Konsum, was den Leistungsabfall im Studio weiter verschärft. Für Trainer sieht das aus wie ein Mangel an Willen; in Wirklichkeit ist es ein Muster aus Selbstschutz, Überforderung und neurobiologischer Dysregulation.
| Anzeichen im Studio | Mögliche Bedeutung | Trainerrelevanz |
|---|---|---|
| Unregelmäßiges Training | Schlafprobleme, Entzugssymptome, Antriebstief | Beobachten, nicht verurteilen |
| Leistungsschwankungen | Schlechtere Regeneration, mentale Erschöpfung | Belastung individuell anpassen |
| Reizbarkeit oder Rückzug | Stress, psychische Belastung, Verdrängung | Gespräche vorsichtig öffnen |
Warum Trainerausbildungen das Thema ignorieren
Der Grund liegt im traditionellen Verständnis des Trainerberufs: körperliche Leistung, Trainingsplanung, Motivation, Technik. Psychische Gesundheit galt lange als „privat“, als Sache von Therapeuten. Doch im modernen Studiokontext verschwimmen diese Grenzen. Ein Trainer, der ein Mitglied dreimal pro Woche betreut, ist oft näher am Alltag dieser Person als jeder Arzt.
Viele Mitglieder erzählen Dinge, die sie niemand anderem sagen würden. Ironischerweise genau dann nicht, wenn es um Cannabis geht. Das Tabu ist groß: Angst vor Bewertung, Angst vor Stigmatisierung, Angst, nicht mehr ernst genommen zu werden. Genau deshalb gehört das Thema eigentlich in jede Ausbildung – gerade weil Trainer keine Therapeuten sind.
Das emotionale Dilemma: Helfen wollen, aber keine Kompetenzen haben
Trainer wollen helfen – das gehört zum Beruf, egal ob es im Lehrplan steht oder nicht. Und sie spüren, wenn jemand „abrutscht“, sich verändert oder im Rückzug steckt. Das emotionale Dilemma entsteht, wenn man zwar merkt, dass etwas nicht stimmt, aber nicht weiß, wie weit man gehen darf. Zu viel Druck erzeugt Abwehr, zu wenig Präsenz lässt Menschen allein.
Die Grenze ist schmal. Besonders schwierig wird es, wenn man einen Rückfall miterlebt, während man selbst glaubt, alles gegeben zu haben. Für Freunde ist dieser Moment existenziell – für Trainer ist er mindestens belastend. Rückfälle sind jedoch kein Zeichen von mangelnder Hilfe, sondern typische Teile eines Abhängigkeitsverlaufs, besonders wenn das Umfeld weiterkifft.
Was Trainer realistisch tun können – und was nicht
Ein Trainer kann eine wichtige Rolle spielen, aber keine therapeutische ersetzen. Was möglich ist: offen zuhören, Veränderungen wahrnehmen und Verständnis signalisieren, ohne Diagnosen oder moralische Zeigefinger. Kleine, realistische Trainingsziele setzen, Routine durch feste Termine aufbauen, Rückfälle nicht kommentieren oder bewerten, sondern Stabilität anbieten. Was unmöglich ist: Ursachen lösen, die psychotherapeutische Hilfe ersetzen oder jemanden „gesund motivieren“. Der wichtigste Satz in diesem Zusammenhang lautet: „Du kannst unterstützen, aber du kannst niemandem den Ausstieg abnehmen.“
| Trainerrolle | Chance | Grenze |
|---|---|---|
| Gespräche öffnen | Mitglied fühlt sich gesehen | Keine Diagnosen stellen |
| Training strukturieren | Stabilität & Routine schaffen | Ersetzt keine Therapie |
| Präsenz zeigen | Vermeidet Rückzug | Kann Emotionen nicht abfangen |
Warum professionelle Hilfe trotzdem nötig bleibt
Auch wenn Sport körperlich stabilisiert, bleibt die Ursache des Konsums oft psychologisch. Viele konsumieren, um zu verdrängen: Stress, Einsamkeit, Überforderung, ungelöste Konflikte. Ohne professionelle Hilfe werden diese Themen selten gelöst. Doch genau hier liegt das deutsche Problem: Psychiater sind schwer zu finden, Wartezeiten frustrieren, und der gesellschaftliche Druck, nicht als „psychisch krank“ zu gelten, ist enorm. Mitglieder öffnen sich oft eher einem Trainer als einem Arzt – weil er nicht urteilt, weil er präsent ist, weil er Teil ihres Alltags ist. Aber gerade deshalb müssen Trainer Grenzen kennen.
Ein Studio ist kein Therapiezentrum – aber ein Ort, an dem Menschen gesehen werden
Fitnessstudios sind soziale Räume. Menschen kommen dorthin, um stärker zu werden – körperlich, mental, emotional. Wenn ein Mitglied in einer Cannabisabhängigkeit steckt, ist das Studio selten der Ort, an dem das Thema zuerst sichtbar wird, aber häufig der Ort, an dem es sich am stärksten äußert: schwankende Leistung, Rückzug, fehlende Energie, Schlafmangel.
Trainer müssen keine Therapeuten werden, aber sie sollten verstehen, dass Sucht im Studio nicht unsichtbar ist. Sensibilität, Empathie und klare Grenzen helfen mehr als jede moralische Predigt. Cannabis wird legaler, aber nicht harmloser – und die Fitnessbranche muss lernen, damit umzugehen.